Forschung
Schwarmverhalten – am Computer simuliert
Viele Tiere – von Fischen bis hin zu Heuschrecken – leben in Schwärmen. Die Wissenschaft ist sich jedoch noch nicht sicher, wie sich dieses Verhalten entwickelt hat. Nun gibt eine Computersimulation Antworten.
Ein roter Punkt, der Jagd auf eine ganze Menge wuselnder weisser Punkte macht. Was aussieht wie eine Variante des Computerspiels «Pacman», ist in Wahrheit die Computersimulation von Forschern der Michigan State University. Die Wissenschaftler um Christoph Adami, Mikrobiologe und Molekulargenetiker, sind den Geheimnissen der Evolution auf der Spur.
Evolution sei ein Abwägen von Kosten und Nutzen, meint Adami. Wenn der Nutzen einer Verhaltensweise deren Kosten überschreitet, steht die Tür zur nächsten Evolutionsstufe offen. Die Verhaltensweise setzt sich durch. Und genau dies war der Fall beim Schwarmverhalten von Fischen, Vögeln und Insekten.
Irritiert durch den Schwarm
Raubtiere, die ihren Blick auf ein einzelnes Beutetier richten können, haben eine viel grössere Chance, es zu fangen als solche, die einen ganzen Schwarm in ihrem Blickfeld haben. Sie werden durch das Gewusel verwirrt, können sich nicht auf das Bewegungsmuster eines einzelnen Tieres konzentrieren und verlieren den Überblick.
Wie sich dieser Vorteil des Schwarmverhaltens evolutionär herausgebildet hat, wollten die Forscher aus Michigan anhand eines Modells herausfinden. Sie entwickelten eine Computersimulation, die auf das Notwendigste beschränkt war: Ein Raubtier, dargestellt als roter Punkt, und eine grosse Anzahl Beutetiere, dargestellt als weisse Punkte.
Dem virtuellen Räuber wurde der Befehl einprogrammiert, Jagd auf die weissen Punkte zu machen. Die Beutetiere wiederum erhielten den Befehl, zu fliehen. In einer ersten Versuchsanordnung erhielten die weissen Punkte den Auftrag, sich so weit wie möglich voneinander wegzubewegen, eine Schwarmbildung also zu vermeiden. Das Ergebnis ist im Video unten zu sehen.
[EXT 1]
Der Räuber hat keine Probleme, sich die Beutetiere zu schnappen. Video: Randal Olson, Michigan State University
Im zweiten Versuch wurde dann eine Schwarmbildung befohlen. Und siehe da, die virtuellen Fische gruppierten sich in mehreren kleinen Kreisen, den Schwärmen und das Raubtier, verwirrt durch zu viele Beutetiere in seinem Blickfeld, geht leer aus und kreist verzweifelt zwischen den Schwärmen.
[EXT 2]
Der Räuber ist durch das Schwarmverhalten verwirrt und kann keine Beute machen. Video: Randal Olson, Michigan State University
Jedes dieser Experimente wurde aus einer zufälligen Ausgangslage über 100 Mal wiederholt. Und das Muster blieb immer dasselbe: In Schwärmen sind Beutetiere deutlich sicherer als einzeln.
Überlebenstrieb als Grund für Intelligenz
Zu verstehen, wie Schwärme funktionieren und wie sie sich evolutionär entwickelt haben, sei ein erster Schritt in Richtung ihres Ziels, schrieben die Forscher in ihrer Publikation im Fachmagazin «Interface» von Mittwoch, 5. Juni. Und dieses Ziel ist hoch gesteckt: «Wir versuchen, den evolutionären Pfad bis hin zur menschlichen Intelligenz digital zu reproduzieren», sagt Randal Olson, Informatiker und Haupt-Autor der Studie.
«Es gibt einen Grund für Intelligenz. Und dieser Grund heisst: Überleben», fügt Christoph Adami hinzu. «Intelligenz erlaubt uns, in die Zukunft zu schauen und sich darauf einzustellen. Und wer am weitesten vorausschauen kann, wird am längsten überleben.»
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
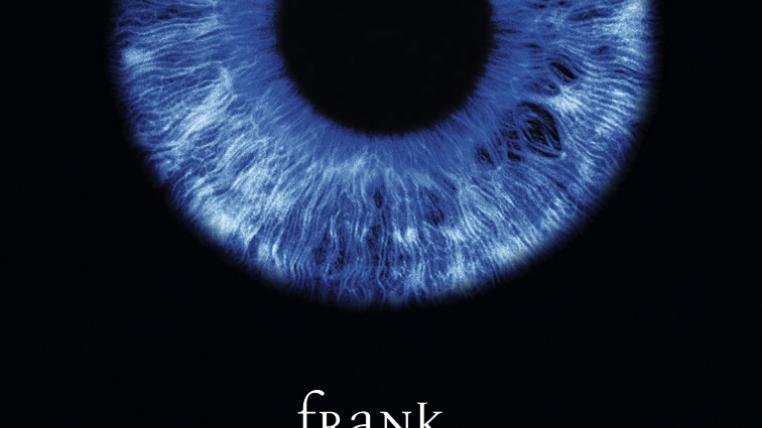















Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren