Fokus
Die Rattenfrage
In vielen Schweizer Städten und Gemeinden werden Ratten regelmässig bekämpft. Die Behörden sehen in ihnen potenzielle Krankheitsüberträger und Kulturschädlinge, deren Populationen es in Schach zu halten gilt. So zum Beispiel in Basel-Stadt. Aber es gibt auch Kritiker.
Von einer Plage kann man in Basel weiss Gott nicht reden. Doch der heisse Sommer 2018 hat die Anzahl an Wanderratten in der Stadt markant ansteigen lassen. Einer der Hauptgründe dafür ist der Mensch, der sich insbesondere an lauen Abenden am Rheinbord und in den Parkanlagen aufhält, dort isst, trinkt und dabei nicht selten einiges an Abfall liegen lässt. Ein reich gedeckter Tisch für die Nager, die sich natürlich nicht zweimal bitten lassen. Haben sie Futter im Überfluss und stimmen auch die übrigen Umweltbedingungen, vermehren sich die Tiere besonders stark.
Um die Rattenpopulation in Schach zu halten, führen die Basler Behörden immer wieder Bekämpfungsaktionen durch. Sowohl oberirdisch als auch unterirdisch. Geht es um das 400 Kilometer umfassende Kanalisationsnetz, ist das Tiefbauamt zuständig. «Wir haben die Stadt in drei Sektoren aufgeteilt: Grossbasel Ost, Grossbasel West und Kleinbasel», sagt Jürg Amatter, Teamleiter Abwasser und eidgenössisch diplomierter Schädlingsbekämpfer.
Dieses Jahr ist der Westen dran. Zusammen mit zwei Mitarbeitern in orange-blauer Arbeitsmontur steht der 54-Jährige an einem kühlen Novembermorgen im Kannenfeldpark. Amatter begleitet die Männer beim Auslegen von Giftködern. «Das ist eine Riesenbüez. Vier Leute müssen innerhalb von zwei Wochen rund 550 Legestellen bedienen», sagt er. Nach Adam Riese macht das pro Arbeitstag 55 Dolendeckel à 100 Kilogramm, also fünfeinhalb Tonnen Gewicht, die jeweils weggehoben und wieder aufgelegt werden müssen.
Lebensmüde Vorkoster
Das Rattengift zu platzieren, ist relativ einfach und schnell gemacht, wie sich schon beim ersten Schacht zeigt. Dazu werden sieben rechteckige 20-Gramm-Pellets, die wie Perlen an einer Kette aufgereiht sind, mithilfe eines Drahts in die Röhre gelassen, bis sie unten auf einem trockenen Bord zu liegen kommen.
Falls keines vorhanden ist, wird der Köder so arretiert, dass er knapp über dem Kanalbett hängt, ohne das Wasser zu berühren. Damit ist die Arbeit aber nicht getan: «Einmal ausgelegt, müssen wir bis Weihnachten alle Köder nochmals kontrollieren. Hat es keinen Frass gegeben, machen wir nichts. Falls doch, legen wir Pellets nach», sagt Amatter. Im Januar schliesslich sammelt das Tiefbauamt alles wieder ein. Allfällige Überbleibsel werden fachgerecht entsorgt.
Bleiben die Köder in einem Netzabschnitt gänzlich unberührt, werden dort künftig auch keine mehr ausgelegt. «Wir müssen ja nicht Gift einsetzen, wo es keine Ratten hat», sagt Amatter. Sofern es wirklich keine hat, denn Ratten sind sehr intelligent (siehe Seite 16). Bevor sich eine Gruppe an einem
Leckerbissen gütlich tut, schickt sie einige Vorkoster voraus. Sterben diese innerhalb einer gewissen Zeit, wissen die anderen, dass sie das erhoffte Futter nicht anrühren dürfen. Deshalb wirken heutige Rattengifte zeitverzögert. Ihre maximale Wirkung entfalten sie nach zwei bis fünf Tagen.
Die Wirkstoffe, die in Rattengift enthalten sind, hemmen die Blutgerinnung, sodass Tiere, die davon fressen, innerlich verbluten. Dies kann laut dem Basler Kantonstierarzt Michel Laszlo grundsätzlich langsam oder schnell erfolgen, abhängig von der Grösse des Tiers, dessen Zustand, der aufgenommenen Giftdosis und der Intensität der Blutung. «Verbluten die Tiere schnell, leiden sie kaum», sagt er. Langsames Verbluten führe dagegen zu einem graduellen, multiplen Organversagen, das je nach Verlauf einschränkend, schmerzhaft und leidvoll sein könne. «Untersuchungen haben ergeben, dass die Ratten bis zu zwei Tage mit Symptomen zu kämpfen haben, bis sie tot sind», sagt Laszlo.
Rodentizide, wie sie in der Fachsprache heissen, sind nicht nur für Ratten oder Mäuse eine Gefahr, sondern auch für andere Kleintiere wie Hunde, Katzen, Eichhörnchen, Marder, Füchse und Vögel, wenn sie davon fressen. Sogar Menschen, insbesondere Kinder, wären beim Verzehr einer genug hohen Dosis gefährdet. Entsprechend gelten im Umgang und in der Anwendung der Köder strenge Sicherheitsvorschriften. Darüber hinaus musste das Basler Kantonslabor mittels Messungen sicherstellen, dass das eingesetzte Gift biologisch gut abbaubar ist und die Wasserqualität nicht beeinträchtigt.
Streit um die Wirksamkeit
Wie viele Ratten es in Basel gibt und wie effektiv der Bestand im Rahmen einer Bekämpfungsaktion dezimiert werden kann, ist nicht bekannt. Zählungen im Untergrund gibt es nicht. Aufgrund des Tierleids und der fehlenden Erfolgskontrolle ist auch umstritten, ob es solche Massnahmen überhaupt braucht. So sieht der Schweizer Tierschutz STS darin eine reine Symptombekämpfung, die langfristig nicht wirksam und oft nicht nötig ist. Ratten mögen Störenfriede sein, doch ihr tatsächliches Schadpotenzial sei hierzulande gering, heisst es.
Im Gesundheitsdepartement von Basel-Stadt weisen die Verantwortlichen derweil auf den Gesundheitsschutz hin, denn: «Wanderratten kommen auf der Suche nach Nahrung in der Kanalisation, in Abfällen und Kompostanlagen, aber auch in Erdhöhlen und Gebüschen mit Erregern in Berührung, die bei Mensch und Tier Krankheiten hervorrufen können», sagt Simon Fuchs, stellvertretender Kantonsarzt und Leiter Sozialmedizin.
Die Liste reicht von Durchfallerkrankungen durch Salmonellen bis hin zu Infektionen durch Leptospiren oder Toxoplasmen. Hinzu kommen Parasiten wie der Rattenbandwurm. Eine Ansteckung sei aber sehr unwahrscheinlich, sagt Fuchs, allem voran dank den Bekämpfungs- und Hygienemassnahmen. Überhaupt kein Thema ist die Pest, deren Erreger heute primär über den Tropischen Rattenfloh übertragen wird. Laut Bundesamt für Gesundheit sind in der Schweiz in den letzten 40 Jahren keine Fälle mehr aufgetreten.
Essen gehört nicht in die Toilette
Eine Übertragung allfälliger Krankheitserreger geschieht meist durch den Kontakt mit Kot und Urin, zum Beispiel, wenn Ratten in Häuser oder Vorratslager eindringen. Aber auch der direkte Körperkontakt stellt ein Risiko dar. Dies betrifft jedoch vor allem die Kanalarbeiter. Fühlen sich die Tiere in die Enge getrieben, beissen sie auch mal zu, was aufgrund ihrer langen, sehr harten Nagezähne zudem äusserst schmerzhaft ist. «Ich musste mal einen engen Gang rückwärts kriechen, als mir von hinten eine Ratte in die Quere kam», erzählt Jürg Amatter vom Tiefbauamt. Sie habe angefangen zu quieken und auf ihm rumzuspringen, weil sie vorbei wollte. Er habe sich deshalb sehr dünn machen müssen, um sie nicht einzuklemmen. «Dann huschte sie mir nah am Kopf vorbei. Das war sehr unangenehm.»
Gift ist nicht das einzige Mittel, mit dem die Basler die Ratten bekämpfen. «Abwasserrohre, die ausser Betrieb sind, werden von uns verschlossen, genauso wie andere mögliche Schlupflöcher, die wir finden», sagt Amatter. So könne man verhindern, dass sich Brutstätten, Vorratslager und Rückzugsorte etablieren. Die Ratten wird man dadurch aber nicht los. Zu perfekt sind sie an ein Leben im Untergrund angepasst. Die Dunkelheit kommt den dämmerungs- und nachtaktiven Tieren genauso entgegen wie die hohe Luftfeuchtigkeit und die mehr oder weniger konstanten gemässigten Temperaturen. Darüber hinaus sind Wanderratten hervorragende Schwimmer und Kletterer.
Am Ende ist es aber doch das Nahrungsangebot, das den Ausschlag gibt. Deshalb treten in Basel, wie wohl in den meisten Städten und Gemeinden, grössere Rattenpopulationen vor allem dort auf, wo es in der Kanalisation Zuläufe von Restaurants, Metzgereien, Bäckereien oder Lebensmittelherstellern gibt. Dankbar sind die Nager auch, wenn Bewohner Essensreste und abgelaufene Nahrungsmittel die Toilette hinunterspülen, anstatt sie mit dem Hauskehricht zu entsorgen. Wie häufig das passiert, ist jedoch schwer zu sagen. Denn im Gegensatz zum Rheinbord und zu den Parkanlagen geschieht diese Form von Littering im Verborgenen.
Dieser Artikel erschien erstmals 2019 in der «Tierwelt».
[IMG 2]
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.









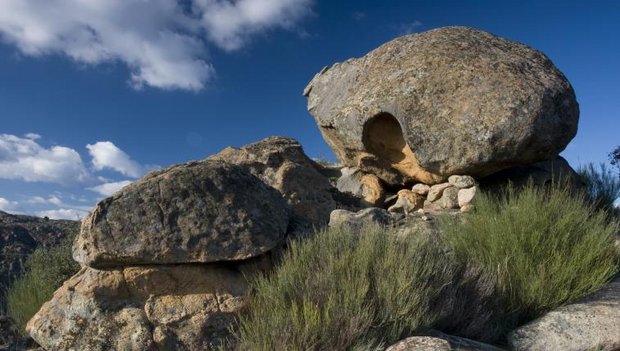






Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren