Insekten und Krankheiten
Winziger Stich, grosse Gefahr
Malaria, Dengue, Gelbfieber, Chagas. Die Liste der von Insekten übertragenen Krankheiten ist lang, die Erfolge im Kampf gegen sie eher dünn gesät. Neue, genetische Methoden könnten den Durchbruch bringen. Manche sind aber höchst umstritten.
Mücken können einen rasend machen. Wer hat nicht schon einmal nachts wachgelegen, einem nervtötend hohen Bsssss gelauscht – und die Verursacherin partout nicht entdeckt, wenn er das Licht angemacht hat? Der Grund dafür, dass ein winziges Insekt einen Menschen um den Schlaf bringen kann, liegt natürlich nicht allein darin, dass weibliche Mücken in einer Tonlage sirren, die unseren Ohren unangenehm erscheint. Unser Unterbewusstsein verbindet das Geräusch mit Gefahr: Schliesslich hat es die Mücke auf unser Blut abgesehen.
Dies wiederum macht einen Mückenstich zwar unangenehm, aber noch lange nicht gefährlich. Trotzdem gelten Stechmücken weltweit gesehen – und hier liegen vielleicht die evolutionären Wurzeln der menschlichen Abneigung – als tödlichste Tiere überhaupt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass jedes Jahr rund eine halbe Million Menschen an einem Mückenstich sterben. Nicht des Blutes wegen, das die Mücken saugen, sondern weil sie als sogenannte Vektoren fungieren. Unbeabsichtigt übertragen sie beim Saugakt eine ganze Anzahl von winzigen Parasiten auf ihr Opfer, die schwere Erkrankungen verursachen.
Den Überträger in Schach halten
Die bekannteste dieser vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten wütenden Krankheiten ist Malaria. Über 400 000 Menschen sterben laut der WHO jährlich daran, die meisten davon Kinder unter fünf Jahren. Daneben gibt es eine ganze Reihe anderer von Mücken übertragenen Erkrankungen (siehe Zusammenstellung Seite 16). Insgesamt geht jeder sechste Fall einer infektiösen Erkrankung weltweit auf die Übertragung durch einen Vektor zurück.
Die Bekämpfung dieser Krankheiten ist eine Herkulesaufgabe. Das liegt daran, dass die Erreger äusserst unterschiedlich und enorm anpassungsfähig sind: Die Palette reicht von Viren (Dengue, Gelbfieber, Chikungunya) über Einzeller (Malaria) bis zu winzigen Fadenwürmern (Filariosen). Wirksame Medikamente oder Impfungen gibt es nur gegen einen Teil der Erkrankungen – zudem besteht bei medikamentösen Behandlungen immer die Gefahr, dass die Erreger gegen die verabreichten Wirkstoffe Resistenzen entwickeln.
Die einfachere, kostengünstigere Methode sei die Bekämpfung des Überträgers, sagt Pie Müller, Spezialist für von Insekten übertragene Krankheiten am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) in Basel. Neben der Medikamenten- und Impfstoffentwicklung wird auch diese Strategie seit Jahrzehnten verfolgt: Man versucht, die Mücken zum Beispiel mit insektizidbehandelten Mückennetzen oder durch Sprühen von Wänden mit Insektiziden zu töten oder durch die Trockenlegung stehender Gewässer die Eiablage zu verhindern.
Doch selbst die Kombination all dieser Massnahmen reicht nicht. Während es bei der Malaria in den vergangenen 20 Jahren immerhin gelang, die Zahl der Todesfälle zu halbieren, sind andere Krankheiten zum Teil sogar auf dem Vormarsch. Ein Extrembeispiel ist das Denguefieber: Vor 1970 registrierte die WHO bloss in neun Ländern schwere Epidemien dieser Erkrankung. Heute gibt es Dengue-Fälle in über 100 Ländern, rund die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in betroffenen Gebieten. In den letzten 30 Jahren stieg die Zahl der Dengue-Erkrankungen um den Faktor 30.
Bestrahlt und freigesetzt
Gründe dafür gebe es verschiedene, sagt Müller. Zum einen mache es die Globalisierung den Mücken allgemein leicht, in neue Gebiete vorzudringen. Zum anderen seien die beiden wichtigsten Dengue-Überträger, die Ägyptische Tigermücke (Aedes aegypti) und die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), äusserst effiziente Krankheitsüberträger und sehr anpassungsfähig. «Ihre Eier überstehen selbst längere Trockenperioden und können sich deshalb zum Beispiel über den Handel mit Altreifen sehr weit ausbreiten», sagt Müller. Auch bei uns: Die Asiatische Tigermücke wurde in der Schweiz im Jahr 2003 erstmals im Tessin beobachtet, heute gibt es auch nördlich der Alpen diverse Funde – allerdings noch keine Dengue-Übertragungen.
Weil die Populationen in der Schweiz noch klein sind, setzt man hierzulande bei der Bekämpfung vorderhand auf herkömmliche Methoden: Im Tessin wird die Bevölkerung angehalten, Wasseransammlungen im Garten (etwa in Giesskannen oder Untersetzern von Pflanzgefässen) zu vermeiden. Zudem versprühen die Behörden gezielt biologische Insektizide, etwa Bt-Toxine, die ein Bakterium namens Bacillus thuringiensis israelensis produziert. In tropischen Gebieten aber sind neue Ansätze gesucht, wenn der Mensch den Kampf gegen die Stechmücken gewinnen will.
Solche Ansätze gebe es, sagt Müller. Es sind Techniken, die zum Teil schon seit Jahren existieren. Eine der bekanntesten Methoden ist ein Verfahren, das unter dem etwas ungelenken Namen «Sterile-Insekten-Technik» (SIT) geläufig ist. Dabei werden im Labor grosse Mengen der schädlichen Insekten gezüchtet. Man sterilisiert die Männchen, meist mittels radioaktiver Bestrahlung, und lässt sie im Bekämpfungsgebiet frei. Wenn sich nun ein dort lebendes Mückenweibchen mit einem solchen Eunuchenmännchen paart, bleibt die Befruchtung seiner Eier aus – die Mückenpopulation verkleinert sich mit der Zeit.
«Mit dieser Technik ist man schon relativ weit», erzählt Müller, «es gibt mittlerweile verschiedene Programme, bei denen Schadinsekten in bestimmten Gebieten auf diese Weise eliminiert oder stark dezimiert werden konnten.» Der grosse Vorteil der SIT ist, dass – anders als zum Beispiel bei Insektiziden – keine Rückstände in der Natur verbleiben. Die sterilen Männchen verschwinden von selber wieder, ohne je einen Menschen gestochen zu haben (denn bei den Mücken nehmen nur die Weibchen Blut auf). Der Nachteil ist, dass Interventionen mit sterilen Männchen einen langen Atem benötigen. Um einen Bestand wirkungsvoll zu dezimieren, muss eine enorme Anzahl solcher Tiere freigesetzt werden, und das über Jahre hinweg.
Larven sterben vor der Verpuppung
Eine besonders raffinierte Abwandlung dieser Methode setzt auf ein faszinierendes Bakterium. Bakterien der Gattung Wolbachia können laut Schätzungen bis zu 70 Prozent aller Insektenarten befallen. Sie leben meist in den Geschlechtsorganen ihrer Wirte und manipulieren deren Fortpflanzung zu ihrem Vorteil. Bei manchen Insekten muss sich ein Weibchen mit einem Männchen paaren, das denselben Wolbachia-Stamm trägt – nur dann sind seine Larven lebensfähig. Setzt man in einem Gebiet also Mückenmännchen frei, die mit einem Wolbachia-Stamm infiziert sind, den es dort nicht gibt, ist der Effekt derselbe wie bei der Sterilen-Insekten-Technik: Der Fortpflanzungserfolg der Mückenweibchen bleibt aus, die Population nimmt ab.
Und es kommt noch besser: Manche Wolbachia-Stämme verhindern oder reduzieren sogar die Vermehrung von Viren wie Dengue oder Chikungunya in ihrem Mückenwirt. Setzt man über einen bestimmten Zeitraum derart infizierte Männchen und Weibchen frei, geschieht Folgendes: Wiederum vermindert sich der Fortpflanzungserfolg der Wolbachia-freien Weibchen der Ursprungspopulation, weil sie mit den eingesetzten Männchen inkompatibel sind. Die freigesetzten Weibchen hingegen vermehren sich und verbreiten im Idealfall Wolbachia in der gesamten Mückenpopulation, die auf diese Weise virenresistent wird. Auch die Wolbachia-Techniken seien schon ziemlich ausgereift, sagt Müller. «Es gibt Firmen, die Wolbachia-modifizierte Mücken anbieten – und in Australien, Singapur, China oder Brasilien hat man recht erfolgreiche Programme durchgeführt.»
Eine dritte Gruppe von Mückenbekämpfungsmethoden, in die Experten grosse Hoffnungen setzen, basiert auf genetisch veränderte Mücken. Wie bei Wolbachia gibt es dabei vereinfacht gesagt zwei Ansätze: eine Mückenpopulation zu verkleinern oder gar zu eliminieren; oder die Population mit weniger gefährlichen Mücken zu ersetzen. Ersteres funktioniert zum Beispiel, indem Biologen einen sogenannten verzögerten Lethalfaktor ins Erbgut von männlichen Zuchtmücken einbauen. «Aus Eiern, die von solchen Männchen befruchtet wurden, schlüpfen zwar Larven», erzählt Müller, «sie sterben aber noch vor der Verpuppung ab.» Die Idee dahinter: Vor ihrem Tod besetzen die nicht lebensfähigen Larven wertvolle Brutplätze und verhindern die Entwicklung anderer Mücken. Programme mit dieser Technik wurden beispielsweise auf den Cayman-Inseln oder in Brasilien mit beachtlichen Erfolgen durchgeführt.
Neue Instrumente zur Vektor-KontrolleInsekten zu sterilisieren oder genetisch zu modifizieren sind vielleicht die spektakulärsten, aber nicht die einzigen Innovationen bei der Bekämpfung von Tropenkrankheiten wie Malaria. Ein Überblick über weitere Erfindungen und Ideen:
Lockfallen: Eine zuckrige, mit einem Insektizid versehene Lösung lockt Mücken an. Nützlinge wie Schmetterlinge sollen der Falle fernbleiben. Hormonähnliche Substanzen: Sie werden in Gewässer gesprüht, in denen Mücken ihre Eier ablegen, und verhindern dort die Entwicklung der Larven. Akustische Insektizide: Wenn Lautsprecher im Wasser Töne einer bestimmten Frequenz aussenden, bringen sie Mückenlarven zum Platzen. Für grössere Gewässer nicht geeignet. Entwurmungsmittel: Studien haben gezeigt, dass das Wurmmittel Ivermectin menschliches Blut für Malariamücken giftig macht. Pilze: Einige Bodenpilze befallen Insekten. Insektenschutznetze werden zum Teil mit den Sporen solcher Arten besprayt. Neue Insektizide: 30 neue Insektenschutzmittel sind in der Erprobung oder schon auf dem Markt.
Vererbt wird nur, was der Mensch will
Noch keine Feldversuche gibt es mit der neuesten, aber auch umstrittensten Methode: dem sogenannten Gen-Drive. Es handelt sich um einen komplexen, ausgeklügelten Mechanismus, den Forscher heute in das Erbgut von Tieren einschleusen können. Dieser sorgt dafür, dass sämtliche Nachkommen dieses Tieres die gewünschte Variante eines Gens erhalten – das Mendel’sche Vererbungsgesetz, wonach verschiedene Genvarianten nach dem Zufallsprinzip vererbt werden, wird ausgehebelt. Ein Gen etwa, das Anopheles-Mücken gegen Malaria resistent macht, könnte sich auf diese Weise rasend schnell ausbreiten. Dieses Potenzial einer lawinenartigen Verbreitung mache die Methode attraktiv, aber auch umstritten, sagt Pie Müller. «Bislang dürfen Gen-Drive-Systeme nur im Labor getestet werden; wenn bloss eine Mücke ins Freie entweicht, könnte dies ungeahnte ökologische Auswirkungen haben.»
Die neuartigen Methoden könnten den Kampf gegen Tropenkrankheiten sicherlich voranbringen, sagt Müller. Er sei aber überzeugt, dass es auch die herkömmlichen Strategien und weitere neue Ansätze brauche (siehe Box Seite 13). «Wir müssen parallel an möglichst vielen Stellen im Lebenszyklus der Stechmücken und der Krankheitserreger ansetzen.» Eine solche ganzheitliche Strategie werde auch für Länder wie die Schweiz immer mehr ein Thema. Denn mit der Klimaerwärmung verschieben sich die Lebensräume der tropischen und subtropischen Mückenarten – und damit auch jene der von ihnen übertragenen Krankheiten. «Vor 30 Jahren», sagt Müller, «hätte niemand geglaubt, dass wir die Asiatische Tigermücke einmal bei uns haben werden. Heute ist klar, dass wir sie nur noch lokal eindämmen können; ihre Verbreitung ganz stoppen, ist mit den heutigen Mitteln praktisch unmöglich.»
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

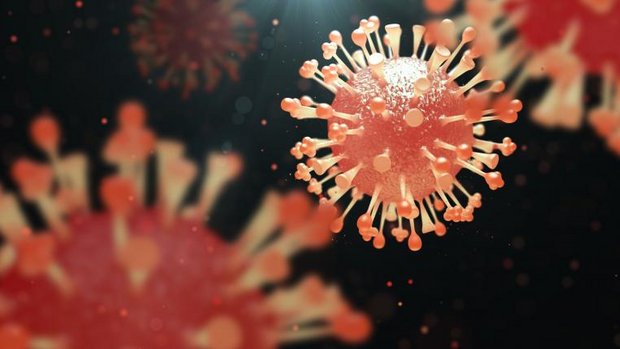













Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren