Psychopharmaka
Antidepressiva für die Katze
Immer mehr Katzen werden wegen Verhaltensauffälligkeiten mit Psychopharmaka behandelt. Gegen den Einsatz von Medikamenten gibt es viele Vorurteile.
Angstlöser, Stimmungsaufheller oder Tabletten, die Aggressionen vermindern oder die Frustrationstoleranz erhöhen: Psychopharmaka werden in der tierärztlichen Verhaltensmedizin regelmässig eingesetzt. Zwar sind Tierhalterinnen und -halter in der Schweiz zurückhaltender als etwa in den USA – trotzdem hat die Verschreibung auch hierzulande eindeutig zugenommen, wie Linda Hornisberger von der Schweizerischen Tierärztlichen Vereinigung für Verhaltensmedizin bestätigt. Weil es in der Schweiz (noch) kein für Katzen zugelassenes Psychopharmakon gibt, müssen die Medikamente von anderen Tierarten und häufig aus der Humanmedizin umgewidmet werden.
Obwohl immer häufiger eingesetzt, gibt es gegenüber Psychopharmaka viele Vorurteile – und dies auf verschiedenen Seiten. Eine grosse Sorge der Besitzer sei, dass sich die Persönlichkeit ihres Tieres durch die Einnahme der Medikamente verändern könnte, sagt Maya Bräm, Verhaltensmedizinerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universitäten Bern und Zürich. Ein weiteres häufiges Thema sei die Angst vor unerwünschten Nebenwirkungen. Auf der anderen Seite werden Tierbesitzer, die sich entschieden haben, ihren Lieblingen Psychopharmaka zu verabreichen, verdächtigt, aus Bequemlichkeit den «einfachen Weg» gewählt zu haben. Oder aber man wirft ihnen vor, die eigentliche Ursache der Verhaltensprobleme ihres Tieres zu sein.
Angst behindert Lernprozesse
Sogar die Tierärzte müssten sich von dem Vorurteil frei machen, dass der Einsatz von Psychopharmaka einem Versagen gleichkommt, die Probleme nicht anders in den Griff zu kriegen, halten die beiden Verhaltensmedizinerinnen Barbara Schneider und Daphne Ketter in ihrem Ratgeber zum Thema fest und weisen darauf hin, dass gut ausgebildete Therapeuten wüssten, dass Psychopharmaka nur ein weiteres Werkzeug seien, das in manchen Fällen «hilfreich, angebracht oder auch einmal unumgänglich» sei.
«Wenn eine Katze leidet, können Psychopharmaka einen wertvollen Beitrag leisten», sagt Verhaltensmedizinerin Bräm dazu: «Vorausgesetzt, die Besitzer können der Katze das Medikament verabreichen, ohne dadurch wiederum viel Stress für die Katze auszulösen.» Die ethische Frage einer medikamentösen Therapie könne in beide Richtungen diskutiert werden.
Zum einen im Sinne einer Kritik, dass man sich etwa dazu entscheidet, einem Tier ein Medikament zu verabreichen, obwohl die Ursache offensichtlich umweltbedingt ist. Beispielsweise wenn eine Auslaufkatze in einer Wohnung mit anderen Katzen gehalten wird und eine Umplatzierung oder ein Umzug für das Tier die richtige Lösung wäre. Auf der anderen Seite kann argumentiert werden, dass bei einer stark verängstigten Katze ein Medikament eingesetzt werden sollte, um ihren Stress zu mindern.
Ein Medikament alleine löst das Problem generell nicht», sagt Bräm. Es könne aber helfen, dass man mit anderen Massnahmen schneller ans Ziel kommt: «Angst hemmt die Möglichkeit, zu lernen. Manchmal muss diese grundlegende Angst erst angegangen werden.» Wichtig sei, dass das Passendste für die Situation und das Individuum gewählt, und dieses von einem Verhaltensspezialisten verschrieben werde. «Ein Psychopharmakon sollte nur nach einer gründlichen gesundheitlichen und Verhaltensabklärung verabreicht werden und nur in Kombination mit anderen Massnahmen wie Anpassung der Umwelt und Verhaltensarbeit.»
Wer stört, fällt eher auf
Die Anpassung der Umwelt sei bei der Katze häufig eine wichtige Massnahme, sagt Bräm. Sie sei kein Fan von Schuldzusprechungen. Es gebe aber tatsächlich Fälle, in denen es sich primär um ein Haltungsproblem oder um ein falsches Verhalten des Besitzers handle. Die allermeisten würden aber ihr Bestes tun, um ihren Tieren gerecht zu werden. Nicht selten sei das Problem ein Zusammenspiel von Katze und verschiedenen Umweltfaktoren wie anderen Tieren im Haushalt, Personen, Kommunikation und Haltungsbedingungen.
Prinzipiell würden eher Tiere dem Tierarzt vorgestellt, die ein «produktives» oder den Menschen störendes Verhalten zeigten wie eben Unsauberkeit oder Aggression. Daraus schliessen, dass Tierhalter nur Hilfe suchen, wenn es für sie mühsam ist, bei einem still leidenden Tier hingegen nicht, will Bräm aber nicht: «Tiere, die ihre Angst eher durch Rückzug oder Meideverhalten zeigen oder sich verstecken, fallen nicht so auf und es wird häufiger ‹übersehen›, dass sie auch leiden.»
Zwangsstörungen, bei denen das Normal- verhalten stark eingeschränkt ist oder es zu Selbstverletzungen kommt, oder demenzartige Veränderungen sind weitere Probleme, die mit Psychopharmaka regelmässig bekämpft werden. «Jegliches körperliche Problem, das zu einer veränderten Wahrnehmung oder zu Schmerzen führt, kann bei einer ängstlichen oder unsicheren Katze zu einer vergrösserten Unsicherheit und Angst führen», sagt Bräm: «Medikamente können in solchen Fällen die Angst und/oder den Stress reduzieren.»
Einmal Pillen, immer Pillen?
Zwar gebe es kein Medikament, das gegen eine spezifische Aggression nütze, aber: «Je nachdem, worauf die Aggression basiert, können solche Medikamente hilfreich sein, die Reizschwelle zu erhöhen, die Impulsivität zu vermindern und die Angst und den Stress zu reduzieren – und somit die Gefahr eines Bisses herabzusetzen.»
Die Angst der Besitzer, die Persönlichkeit ihres Tieres würde durch die Pillen verändert, sei unbegründet, sagt Bräm: «Die Persönlichkeit bleibt gleich. Der Medikamenteneinsatz soll lediglich dem Tier helfen, besser mit Situationen umgehen zu können. Auch in Bezug auf die Angst vor Nebenwirkungen gibt Bräm ein Stück weit Entwarnung: «Nebenwirkungen sind selten. Und wenn sie auftreten, so verschwinden sie meistens nach einigen Tagen. Zudem wissen wir, dass chronischer Stress längerfristig auch ‹Nebenwirkungen› hat». Deshalb sei ihr gerade in der Anfangsphase der medikamentösen Therapie ein enger Kontakt mit den Besitzern wichtig: «Damit sie mir ihre Beobachtungen schildern und wir entscheiden können, ob und wie wir die Medikation weiterführen.»
Wie lange ein Tier ein Medikament jeweils brauche, sei von verschiedenen Faktoren abhängig, erklärt Bräm, und zwar vom Tier selbst, von den auslösenden und fortbestehenden Stressfaktoren oder von den Anpassungsmöglichkeiten des Systems und der Umgebung. Häufig könne man das Medikament wieder «ausschleichen», also langsam reduzieren bis auf null. Manchmal benötigen die Tiere aber auch eine lebenslängliche Unterstützung: «Weil sie dadurch eine höhere Lebensqualität haben.»
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.














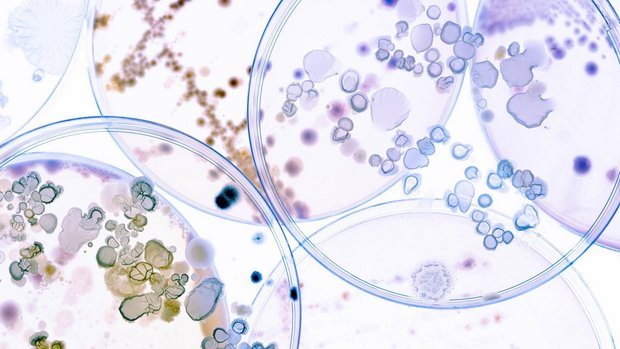
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren