«Tierwelt»-Förderpreis
«Wir wollen überzeugen, nicht zwingen»
Der «Tierwelt»-Förderpreis geht dieses Jahr an Lebensraum Landschaft Cham. Der Verein setzt sich im Auftrag der Gemeinde dafür ein, dass die Natur im dicht besiedelten Gebiet für Mensch und Natur aufgewertet wird.
Cham liegt idyllisch am Zugersee, mit grosszügigen Parkanlagen am Seeufer. Doch die drittgrösste Gemeinde des Kantons Zug ist auch eine typische mittelständische Vorortsgemeinde: Viele Mehrfamilienhäuser stehen hier, ein Gürtel von Einfamilien- und Reihenhäusern, etwas Industrie, ein Autobahn-Dreieck. Intensiv bewirtschaftete Felder und Wiesen, unterbrochen von Wäldern, wo Jogger und Hündeler unterwegs sind.
Nicht die Idylle, aber etwas Natur wollte die Gemeinde zurückbringen, als sie sich 2006 ein Landschafts-Entwicklungs-Konzept LEK gab. Damit wollte sie zeigen, wo die Natur in welcher Form zu ihrem Recht kommen sollte. Die Umsetzung des LEK legte sie mittels Leistungsvereinbarung in die Hände des Vereins Lebensraum Landschaft Cham, der allein zu diesem Zweck gegründet wurde. Eine kluge Entscheidung, wie sich zeigen sollte. «Als Verein, der sich aus Freiwilligen zusammensetzt, haben wir einen leichteren Zugang zu den Betroffenen als eine Verwaltungsabteilung der Gemeinde», meint Vereinspräsident Adolf Durrer, der in den 1980er-Jahren Bauchef der Gemeinde war.
Bürgernah will der Verein sein, hinhören, Bedürfnisse wahrnehmen und diese möglichst in die Massnahmen integrieren. In diesem Frühling forderte der Verein die Bevölkerung auf, «grünaktiv» zu werden. Bürgerinnen und Bürger sollten Vorschläge machen, wo Cham «grün wachsen» soll – will heissen: wie sich Grünflächen aufwerten lassen, wo die Natur mit geringem Aufwand besser zum Zug kommen könnte, welche Projekte auf ihre Umsetzung warten. Die eingereichten Ideen werden nun geprüft und sollen als Basis für die Arbeit der nächsten Jahre dienen.
Vieles erreicht, vieles bleibt zu tun
«Es gibt Gebiete, wo der Mensch Vorrang hat, solche, wo die Natur Vorrang hat, und solche, wo beide nebeneinander existieren sollen», sagt Durrer. Im Feuchtgebiet Lorzenpark etwa wurde mit dem Amphibienweiher gleich nebenan auch ein Picknickplatz gebaut. Von dort aus lässt sich gut beobachten, was sich im kleinen Gewässer tut. Der direkte Zugang zum Teich ist zwar nicht abgesperrt, aber auch nicht ausgebaut. Es sei nicht die Idee, dass die Menschen unmittelbar zum Teich gingen, sagt Durrer. «Aber wir wollen möglichst keine Verbotstafeln stellen.»
Zwar hat der Verein viel mit Gesetzen und Verordnungen zu tun. Doch anders als eine Gemeinde- oder Kantonsstelle ist er nicht verpflichtet, auf den Buchstaben des Gesetzes zu pochen. «Wir bauen auf Dialog, wir wollen überzeugen, nicht zwingen», sagt Durrer. Überdies kann sich der Verein Zeit lassen. Zeit, bis Betroffene überzeugt sind. Oder auch Zeit, bis sich Massnahmen mit anderen Projekten verbinden lassen – etwa einer Überbauung, einem Strassenprojekt oder ökologischen Massnahmen des Kantons.
Seitdem Lebensraum Landschaft Cham vor acht Jahren entstand, sind in der Gemeinde verschiedene Feuchtgebiete entstanden, sind eingedolte Bachläufe freigelegt und Obstalleen gepflanzt worden. Waldränder wurden aufgewertet und über die Autobahn wurde eine Wildbrücke erstellt, die auch von Menschen genutzt wird. Und immer war Lebensraum Landschaft Cham beteiligt. «Wir springen dort in die Lücken, wo es keinen gesetzlichen Auftrag und entsprechend keine Gelder der öffentlichen Hand gibt», erklärt Durrer, der wie alle Mitglieder ehrenamtlich arbeitet. Dort kann der Verein ebenfalls Geld sprechen, allerdings bewegen sich diese eher auf der Ebene einer Anerkennung als einer Entschädigung. Bei der Finanzierung war die Gemeinde kreativ: Die Gebühr, die für das Ablagern von Schutt in einer Deponie erhoben wird, geht an den Verein.
Mischung aus Eigeninitiative und Behörde
Für Adolf Durrer ist die Verleihung des «Tierwelt»-Förderpreises von Kleintiere Schweiz «eine Anerkennung, dass unsere Arbeit in die richtige Richtung geht». Wo sich Menschen ehrenamtlich engagierten, brauche es Motivation, und der Förderpreis sei zweifellos eine solche. Was mit dem Betrag von 5000 Franken passiert, legt der Vereinsvorstand im November fest. Eines aber ist bereits klar: «Wir werden damit ein spezielles Projekt verwirklichen.»
Lebensraum Landschaft Cham setzte sich in der Jury von Kleintiere Schweiz gegenüber 24 anderen Einzelpersonen, Vereinigungen und Verbänden durch. Überzeugt habe einerseits die Mischung aus Eigeninitiative und Behörde, sagt Heinz Wyss, Geschäftsführer von Kleintiere Schweiz. «Andererseits konnten dank des Vereins natürliche Ressourcen zurückgeholt und damit Lebensraum für Tiere geschaffen werden.»
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

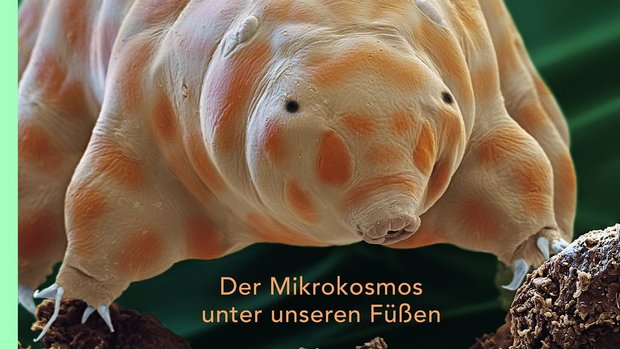












Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren