Land- und Forstwirtschaft
Problem Bodenverdichtung: Wie schwere Maschinen unseren Boden unter Druck setzen
Der Boden ist eine Lebensgrundlage. Ökologisch und ökonomisch von immensem Wert, ist die Ressource gefährdet: Durch den Einsatz schwerer Maschinen wird sie verdichtet. Der Boden ist unter Druck – wortwörtlich.
In einer Handvoll Boden gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde.» Von wem dieser Satz genau stammt, ist unbekannt. Dennoch wird er sinngemäss immer wieder verwendet, um zu veranschaulichen, wie viel Leben unter unseren Füssen herrscht.
Der Boden ist die Heimat von Mikroorganismen, Bakterien, Pilzen, Insekten, Algen und zahlreichen grösseren Bodentieren. Er filtert Regenwasser und Nährstoffe, um sie an Pflanzen abzugeben. So dient er parallel nicht nur der Grundwasserfilterung, dem Hochwasserschutz, dem Abbau von organischem Material und dem Speichern von Kohlenstoff, sondern bildet zusammen mit Luft und Wasser die Grundlage für neues Leben.
Doch die natürliche Ressource ist in vielerlei Hinsicht gefährdet. Gravierend ist unter anderem das Problem der Bodenverdichtung: Durch äusseren Druck auf den Boden wird dieser zusammengedrückt; die Porenräume zwischen den Bodenpartikeln werden verringert oder verschwinden ganz. Dieser äussere Druck entsteht vor allem, wenn schwere…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.















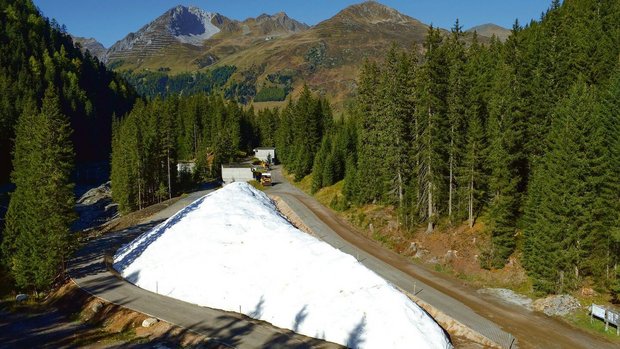
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren