Neue Datenbank
Konflikt beeinflusste Verteilung der BVD-Viren
Um die weltweit auftretende Rinderkrankheit BVD (Bovine Virusdiarrhö) in der Schweiz besser bekämpfen zu können, haben Forschende der Universität Bern eine Datenbank von BVD-Viren angelegt.
Die Forscher stellten fest, dass ein Konflikt wegen drei Päpsten die Verteilung von genetisch unterschiedlichen Viren beeinflusst hat.
Eine Gruppe von Forschenden um Ernst Peterhans, emeritierter Professor der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, befasst sich seit über 25 Jahren mit der Rinderkrankheit BVD, wie die Universität am Mittwoch mitteilte.
Diese Infektionskrankheit wurde erst 1946 entdeckt und in der Schweiz 1964 erstmals nachgewiesen. Mit ihrer Arbeit konnten die Forschenden zeigen, dass das Virus in der Schweiz seit mindestens 600 Jahren heimisch war.
7500 einzelne Datensätze
In der Schweiz ist die BVD heute nahezu ausgerottet. Weltweit treten aber immer wieder neue Infektionen auf. Mit der Methode der molekularen Epidemiologie kann die Quelle eines solchen Ausbruchs zurückverfolgt werden. Dabei können Sequenzen aus der Erbsubstanz der BVD-Viren analysiert und verglichen werden.
Um die Bekämpfung der Krankheit weiter zu verbessern, erstellten die Forschenden der Universität Bern eine Datenbank mit den Gensequenzen von BVD-Viren, die in der Schweiz entdeckt wurden. Diese wurden dann mit detaillierten Daten der einzelnen Tiere, aus denen die Viren isoliert worden waren, kombiniert. Diese Sammlung umfasst rund 7500 einzelne Datensätze und ist die bisher weltweit grösste Datenbank dieser Art.
Untersuchungen des genetischen Codes
Laut Peterhans habe man «aus Neugier» wissen wollen, ob zwischen dem genetischen Code der untersuchten Viren und den Eigenschaften ihrer infizierten Wirtstiere Zusammenhänge existierten. Überraschend habe man herausgefunden, dass zwei grosse Populationen der untersuchten Rinder mit jeweils zwei unterschiedlichen Unterarten von BVD-Viren infiziert waren.
Eine Population habe mehrheitlich aus Tieren der Fleckvieh-Rasse, die andere aus Tieren der Braunvieh-Rasse bestanden, den zwei wichtigsten traditionellen Viehrassen der Schweiz. Die Fleckvieh-Rasse geht ursprünglich auf das Simmentaler-Vieh aus dem Berner Oberland zurück. Braunvieh hat seinen Ursprung in der Zentralschweiz.
Brünig-Napf-Reuss-Linie
Die sogenannte Brünig-Napf-Reuss-Linie trennt die Schweiz in zwei volkskundlich unterschiedliche Teile. Der westliche Teil gehörte um das Jahr 900 zum Königreich Burgund, der östliche zum Herzogtum Schwaben. Braunvieh stammt aus der Innerschweiz im östlichen Teil, Fleckvieh aus dem Berner Oberland im westlichen Teil.
Verbreitung geht auf ein religiöses Machtgerangel zurück
Dank Historikern fanden die Forschenden der Vetsuisse-Fakultät heraus, dass diese Verbreitung auf ein religiöses Machtgerangel im 15. Jahrhundert zurückgeht. Zur Zeit des Königreichs Burgund und des Herzogtums Schwaben war die Viehzucht auf die Alpen konzentriert. Die Ausdehnung auf die tieferliegenden Gebiete der Schweiz können auf das Konzil von Konstanz (1414-1418) zurück geführt werden.
Dort versuchte der deutsche König Sigismund den Konflikt zu lösen, der durch drei Päpste entstand, die gleichzeitig die Kirche führen wollten. Es kam zu einem Streit zwischen dem König und dem Österreichisch-Habsburgischen Herzog Friedrich IV.
Der Herzog wurde bestraft, indem der König die Eidgenossen aufforderte, dessen Stammland im Aargau zu besetzen. Dabei eroberten die Berner 1415 grosse Teile des Aargaus entlang der Aare und westlich der Reuss, und die anderen Eidgenossen marschierten in die Gebiete östlich der Reuss ein.
Durch diese und darauffolgende Eroberungen seien zwei grosse Gebiete entstanden, in denen sich Fleckvieh und Braunvieh unabhängig voneinander ausbreiteten und diese jeweils ihren BVD-Virentypus bewahrten, stellten die Forschenden fest.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.












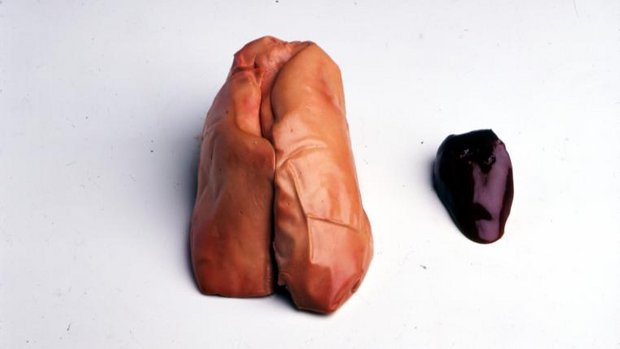


Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren