Brauchtum
Innerschweizer Wilderergeschichten
Geschichten über die illegale Jagd sind die Kriminalromane unserer Ahnen. Im Kanton Nidwalden ist ihre Überlieferung bis heute Tradition – in der Familie, am Stammtisch, in Buchform oder auf der Bühne.
Man schreibt den 14. Oktober 1899. Der Obwaldner Wildhüter Werner Durrer und sein 23-jähriger Sohn Josef sind unterwegs im Wildbann auf der Gruobialp im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Obwalden und Nidwalden. Sie überraschen zwei Nidwaldner Jäger, die auf Obwaldner Boden mehrere Gämsen gewildert haben. «Ergebt euch, Waffen ab!», rufen sie den Wilderern zu. Doch einer von ihnen, Adolf Scheuber, hebt sein Gewehr und erschiesst zuerst Vater Durrer, dann den Sohn.
Zwar kann die Polizei den Täter rasch fassen und abführen. Doch bei der Überführung gelingt Adolf Scheuber die Flucht. In einer Kurve springt er aus dem fahrenden Zug und verschwindet. «Adolf ausgerissen, konnte nicht mehr eingefangen werden. Polizist», schreibt der nachlässige Gesetzeshüter am 16. Oktober um 19 Uhr in einem Telegramm an Verhörrichter Odermatt in Stans. Scheuber gelingt die Flucht ins Ausland – irgendwo in Südamerika verlieren sich seine Spuren.
Die Geschichte dieses Doppelmordes ist in der Innerschweiz bis heute präsent. «Mit der Zeit formte sich aus den Fakten, Vermutungen und Interpretationen ein eigenständiges Erzählgut, das in vielen Familien bis in die heutige Zeit mündlich weitergegeben wird», schreibt das Bundesamt für Kultur in seiner Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz, in welche die Wilderergeschichten aufgenommen wurden.
Viele Zutaten für Gesprächsstoff
Dass über den Fall noch immer diskutiert werde, liege sicher daran, dass er viel Raum für eigene Auslegungen lasse, sagt der Historiker Michael Blatter, der ein Buch über den Wildererfall geschrieben hat. «Scheuber wurde nie erwischt, es gibt keine unabhängigen Aussagen.» Deshalb wisse man nicht, weshalb Scheuber den Mord begangen habe – oder ob der Wildhüter wirklich «Ergebt euch, Waffen ab!» gerufen habe, wie es heute kolportiert wird. Daneben enthält die Bluttat von der Gruobialp aber noch weitere Zutaten, die sie zum Gesprächsstoff machten. Da ist zum einen die Rivalität zwischen Obwalden und Nidwalden, die es noch heute gibt – und die in der grenzüberschreitenden Wilderei Scheubers mitschwang. Und da sind zum anderen brutale Einzelheiten der Tat. So hat Scheuber Werner Durrer ins Gesäss geschossen, als dieser bereits leblos am Boden lag.
Schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nutzten mehrere Schriftsteller und Theaterschaffende die Wilderergeschichte von der Gruobialp als Vorlage für ihre Werke. Gleichzeitig wurde die Geschichte in Nidwaldner Familien, an Stammtischen und an Vereinsanlässen von Generation zu Generation weitergegeben.
Ihm habe sein Vater die Geschichte erzählt, sagt zum Beispiel Klaus Odermatt, Dachdecker und Theaterschaffender aus Dallenwil. Er bezeichnet den Mordfall als «hartnäckige Sache», die in der Region noch immer in den Köpfen der Menschen stecke. Als Odermatt Ende der 1990er-Jahre realisierte, dass sich die Bluttat bald zum hundertsten Mal jähren würde, beschloss er, daraus ein Theaterstück zu machen. Das Stück mit dem Namen «Die eine wilde Jagd» wurde 1999 von der Theatergesellschaft Dallenwil aufgeführt. Es wurde ein solcher Erfolg, dass die Laiendarsteller es zehn Jahre später gleich noch einmal ins Programm aufnahmen – als Freilichtspiel diesmal inmitten der Alpweiden des Bergdorfes Niederrickenbach. Auch diesmal geriet die Produktion zu einem Publikumsrenner – alle 22 Aufführungen waren ausverkauft.
Das Leiden der Daheimgebliebenen
Odermatt führt den Erfolg des Theaterstücks auch darauf zurück, dass der Erzählstoff in der Region breit verankert sei. «Wenn dann wieder jemand etwas daraus macht, dann interessieren sich die Leute natürlich dafür – und wollen wissen, ob es gar etwas Neues zu der Geschichte gibt.» Er sei überzeugt, dass auch eine Aufführung anlässlich des 120-jährigen Gedenkens, im Jahr 2019, auf riesiges Interesse stossen würde.
Der Doppelmord auf der Gruobialp ist allerdings längst nicht die einzige Wilderergeschichte, die in Nidwalden kursiert. Oft hätten diese Erzählungen einen realen Hintergrund, sagt Michael Blatter. So sei belegt, dass einst ein Wildhüter den Freund eines Regierungsrates beim Wildern erwischt habe. Bestraft wurde der Wilderer nicht – stattdessen verlor der Wildhüter seine Stelle. Im Lauf der Jahre werden solche Geschichten dann ausgeschmückt, zugespitzt oder abgewandelt – so dass am Ende nicht mehr ganz klar ist, was nun Fakt und was Fiktion ist.
Vielfach spürt man in den Geschichten Verständnis und Sympathie für die Wilderer. Manchmal habe er sogar das Gefühl, dass die Wilderei verklärt werde, sagt Klaus Odermatt. Das Bundesamt für Kultur führt dies darauf zurück, dass «die Wesenszüge der Naturverbundenheit, der Freiheitsliebe und der Abenteuerlust» in Nidwalden grosse Sympathien geniessen würden.
Eine Rolle spiele wohl auch die Auflehnung gegen das Gesetz, sagt die Nidwaldner Filmemacherin und Videokünstlerin Thaïs Odermatt. Sie hat im Jahr 2009 mit dem Kurzfilm «Nid hei cho» einen Kontrapunkt zu diesem Heldentum gesetzt. «Nid hei cho» ist eine (wahre) Wilderergeschichte, die menschliche Schicksale ins Zentrum rückt. Eine Witwe erzählt von der Leidenschaft, ja Sucht ihres Mannes für die Wilderei. Wie es ihn immer wieder mit der Flinte in die Berge zog. Über ihre Angst, dass er erwischt werde. Und über jenen Tag vor etwa 30 Jahren, als er tatsächlich nicht mehr zurückkam – weil er bei einem Wilderei-Unfall ums Leben gekommen war. Auch diese Wilderergeschichte wird in Nidwalden mündlich überliefert. «Mein Vater hat sie mir erzählt und als ich ein Kind war, waren wir auch einmal auf der Alp, auf der der Unfall geschah», sagt Thaïs Odermatt.
Mit Schalldämpfer und Nachtsichtgerät
«Nid hei cho» zeigt auch exemplarisch, dass die Wilderei in der Schweiz nicht bloss ein Relikt aus vergangenen Zeiten ist. Noch heute gibt es Menschen – längst nicht nur im Kanton Nidwalden –, die illegal auf die Jagd gehen. Oftmals spielt ihnen die moderne Technik in die Hände. Sie sind ausgerüstet mit verkürzten Gewehren, die in einen Rucksack passen, mit Nachtsichtgeräten und Schalldämpfern – und darum für Wildhut und Polizei schwierig zu fassen.
Doch je besser, blutrünstiger oder unglaublicher diese modernen Wilderergeschichten, desto grösser ist auch das Bedürfnis, sie zu erzählen. Und manchmal helfen die mündlichen und schriftlichen Überlieferungen dabei, einen Wilderer vor Gericht zu stellen. So wie bei jenem heute über 90 Jahre alten Walliser, der vor zwei Jahren in einem Zeitungsinterview damit geprahlt hatte, schon mehr als hundert Tiere illegal getötet zu haben – darunter auch geschützte Arten wie Luchse. Die Naturschutzorganisationen WWF und Pro Natura zeigten den Mann daraufhin an. Denn vom Bund als Tradition gewollt und zugelassen ist nicht die Wilderei selbst, sondern nur die Geschichten darüber.
Schauen Sie sich den Kurzfilm «Nid hei cho» der Nidwaldner Filmemacherin Thaïs Odermatt an:
[EXT 1]
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

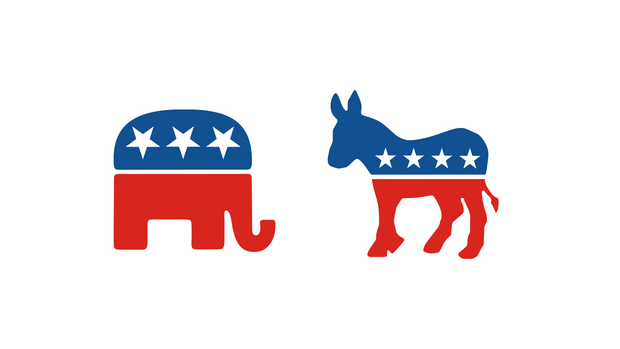







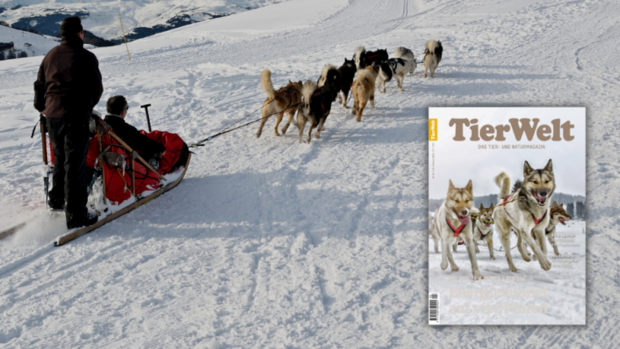


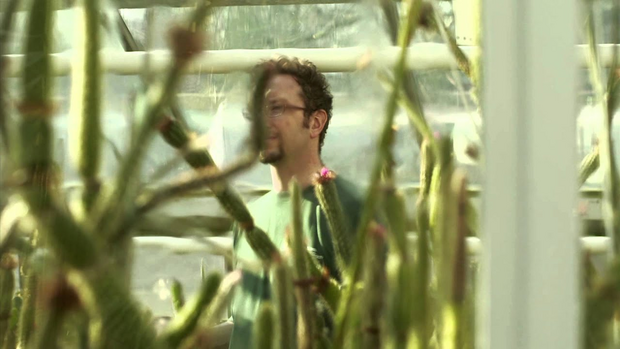
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren