Buchtipp
Lebendige Kunst mit leblosen Tieren
Die Taxidermie – so nennt sich die Kunst der Tierpräparation – kennt viele Facetten. Ob lebensechte Abbilder der Natur oder absurd entstellte Tierfratzen: Das Buch «Ausgestopft!» entführt den Leser in die lebhafte Welt der toten Tiere.
In jedem Naturmuseum können heutzutage kunstvoll präparierte Wildtiere bewundert werden: Zähnefletschende Löwen in naturgetreuen Posen, erstarren mitten im Angriff auf eine flüchtende Gazelle. Wenige Meter daneben unbekümmert grasende Zebras, im Hintergrund vielleicht eine Hyäne, die gierig auf die potenzielle Beute schielt. Alles aufbereitet in einer grossen Vitrine, der Boden detailgetreu mit Savannengewächsen gestaltet, die Rückwand in den Brauntönen der endlosen Weite Afrikas bepinselt. Präparierte Tiere dienen dem Museumsbesucher als Fernglas in exotische Faunen, als Sehnsuchtsstätten und Fluchtmöglichkeiten aus dem Alltag. Das war schon früher so. Aber nicht nur.
Das Buch «Ausgestopft! Die Kunst der Taxidermie» befasst sich auf gut 250 Seiten mit der Geschichte des «Ausstopfens», oder, besser, der Dermoplastik oder Taxidermie. Diese Ausdrücke treffen das tatsächliche Metier von Tierpräparatoren nämlich besser. Aus dem Griechischen «táxis», arrangieren, und «dérma», Haut, ergibt sich das heute gebräuchlichste Wort für dieses Handwerk. Ein Handwerk, das gar nicht so alt ist, wie man denken könnte: Zwar wurden schon bei den alten Ägyptern Tiere einbalsamiert und somit über Jahrtausende hinweg haltbar gemacht, doch mit der heutigen Taxidermie hatte das damals nichts zu tun. Bis ins Mittelalter war dann einzig der Mensch der Mittelpunkt der Welt, Tiere interessierten damals kaum.
«Wunderkammern» für die Neugier
Erst ausgangs des 16. Jahrhunderts kam diese Neugier auf, die bei uns Menschen auch heute, im Internetzeitalter, noch kaum ausreichend befriedigt wird. Eine Neugier nach dem Fremden, dem Unbekannten, dem Kuriosen. Und so waren auch die ersten «ausgestopften Tiere» in Kuriositätenkabinetten zu sehen, in sogenannten «Wunderkammern». Zunächst waren es einfach zu präparierende Exponate, die dem Besucher dort vorgeführt wurden. Muschelschalen etwa, oder Tierhörner. Doch bald schon gesellten sich auch Vögel und erste vollständig präparierte Säugetiere dazu.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="77cb5679-262a-444e-88dd-d404b4def3d5" data-langcode="de"></drupal-entity> |
| Wohnzimmer eines Hauses in Dallas, Texas. Bild: © Kelle Bryant |
Ihre erste Hochblüte erreichte die Taxidermie dann im Kolonialzeitalter. Wer etwas auf sich hielt, ging auf Grosswildjagd und brachte Schädel, Geweihe und Hörner mit nach Hause und schmückte damit seine Rauchersalons. Die Dame von Welt stellte sich bunte Vögel unter Glasglocken aufs Schminktischchen und in den geräumigen Wohnzimmern stand gerne mal ein präparierter Braunbär herum. Es war das erste Zeitalter der Präparatoren. Mit allen Händen voll zu tun und immer genügend Nachschub aus den afrikanischen und asiatischen Kolonien perfektionierten sie ihre Kunst. Die anfangs noch schludrig zusammengebastelten Tierpräparate, die heute eher belustigend wirken, wichen bald beängstigend echt aussehenden Kunstwerken der Taxidermie.
«Freak-Show» mit Tieren
Doch nicht alles sollte «echt» aussehen. Das 19. Jahrhundert war auch die grosse Zeit der anthropomorphen Szenen. Tiere in menschlichen Posen kamen in der Kunst in Mode. Bilder von pokerspielenden Hunden sind heute noch oft gesehen, doch Präparate von boxenden Eichhörnchen und billardspielenden Fröschen sind aus heutiger Sicht doch arg skurril und tierethisch zumindest fragwürdig. Und auch vor Missbildungen der Natur wurde kein Halt gemacht. «Echte» sechsbeinige Lämmer wurden genauso präpariert wie gefälschte zweiköpfige Kälber. «Freak-Shows» kamen eben schon immer gut an.
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="cb6ea0fb-5c31-4e1e-9eb5-f24a41cbe90c" data-langcode="de"></drupal-entity>
Boxende Eichhörnchen – vom Händeschütteln bis zum K.O. Bild: © Owen Smith/London Taxidermy
Nach dem Ersten Weltkrieg schien die Zeit der Taxidermie vorüber zu sein. Die Grosswildjagd war nun nicht mehr geachtet, sondern verpönt, viele grosse Jäger konvertierten zu Naturschützern, man begann um das Überleben bedrohter Tiere zu kämpfen – in der Wildnis, nicht in der Stube.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="8a520bc6-c8a7-47ff-9507-ba2556881c94" data-langcode="de"></drupal-entity> |
| Werbefoto für einen Tapetenhersteller. Bild: © Joakim Blokstrom/Cole & Son. |
Doch mittlerweile ist das «Ausstopfen» wieder salonfähig geworden. Exotische Tiere werden kaum mehr fürs reine Vergnügen gejagt, doch stirbt eines im Zoo oder bei einem Unfall, kann sich der Präparator ohne schlechtes Gewissen an seine Verarbeitung machen. Durch die moderne Technik hat sich bei professionellen Tierpräparatoren ein hohes Niveau eingebürgert; präparierte Tiere sind heute Kunstwerke. Von Hand geschaffen. Eine Rückbesinnung auf das vom Aussterben bedrohte Handwerk.
Vielschichtig wie die Gesellschaft
Auch die Wirtschaft hat den wieder aufkommenden Trend aufgenommen. In Kleidergeschäften sitzen präparierte Kaninchen zwischen modischen Schaufensterpuppen, auf Plakaten werben Tukane für die Uhren, die an ihren Schnäbeln hängen und in Designerläden springen halbe Zebras aus der Wand.
Die Kunst der Taxidermie war und ist so vielschichtig wie die Gesellschaft. Zwischen grauenvoll und wunderschön, zwischen abstossend und anziehend. Immer auf der Schwelle vom und zum ethisch Vertretbaren.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="044666af-371e-4d5d-9cc0-78ec8d96ccc2" data-langcode="de"></drupal-entity> |
| Alexis Turner: «Ausgestopft! Die Kunst der Taxidermie», gebunden, 256 Seiten, Verlag: Brandstätter, ISBN: 978-3-850-33734-2, Fr. 47.90 |
Das Buch «Ausgestopft!» wertet nicht. Es zeigt auf, und zwar umfassend, wie viele Dimensionen die Taxidermie enthält. Übersichtlich gegliedert in Kategorien und Epochen schildert es das Auf und Ab dieses Kunsthandwerks und illustriert es mit Hunderten von Farbabbildungen. Jeder, der sich mit einem nostalgischen Seufzer erwischt, wenn er an die Museumsbesuche seiner Kindheit zurückdenkt, sollte mindestens einen Blick in das Buch werfen. Er wird nämlich richtig schlau daraus. «Ausgestopft!» entfacht Freude, Bewunderung, aber zuweilen auch Ekel oder Abscheu beim Anblick makaberer Präparate. Auf jeden Fall entfacht es aber einen ungeheuren Respekt für die Meister der Tierpräparation von damals und heute.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


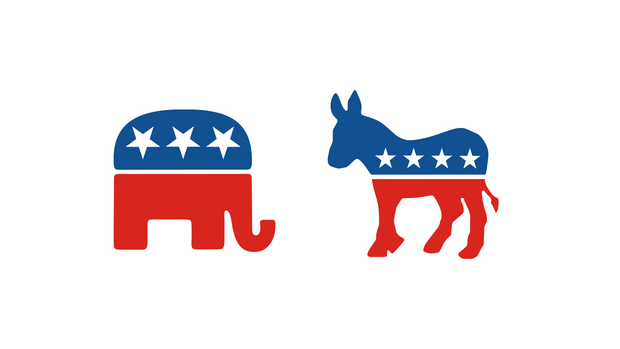







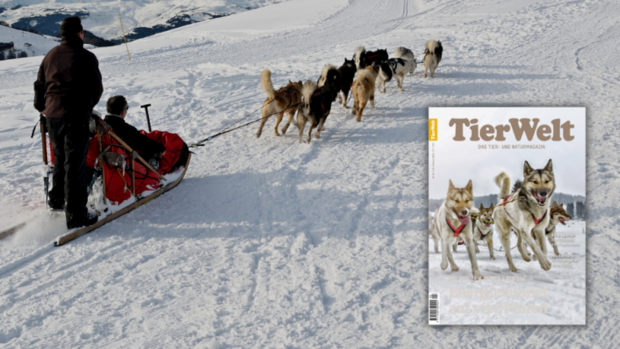


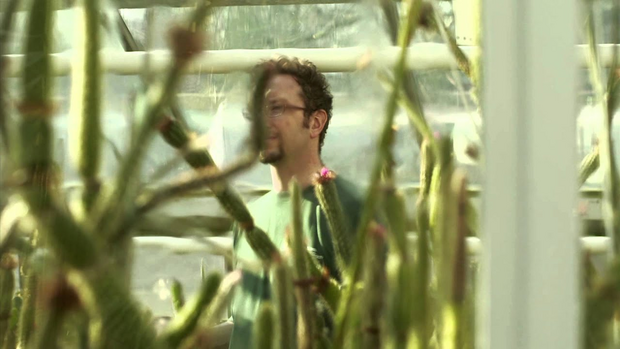

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren