Samichlous
Rudolf, Sleipnir und das «Eseli»
Am Freitag ist wieder «Chlousetag». Zeit, sich zu freuen. Auf den Samichlous, auf Nüsse, Schokolade, Mandarinen – und auf das «Eseli». Wenn es denn kommt.
«Samichlous, du liebe Maa
Gäu i muess kei Ruete haa?!
Gimer lieber e Tafele Schoggolaa
Ds Papier chasch wider umehaa!»
Nein, so frech war ich natürlich damals nicht. Ich hatte einen riesigen Respekt vor diesem rotgekutteten, bauschebärtigen Samichlous, der jedes Jahr am 6. Dezember ins Quartier kam, um uns mit «Nüssli, Schoggi und Mandarindli» zu belohnen, wenn wir gute Kinder waren. Oder aber uns mit der Rute zu drohen, wenn wir im vergangenen Jahr nicht brav waren. Ich glaube uns Kinder hat’s nie erwischt, aber ab und zu hat der eine oder andere Papi mal eine gekriegt. Das hat gewirkt! Zumindest für die nächsten paar Tage waren wir Quartierkinder danach lammfromm.
Der Samichlous sieht schliesslich alles, von dort oben auf dem Belpberg. Dort wohnt er nämlich, zumindest der Samichlous, der jeweils zu mir kam. Mit seinem Eseli kam er immer heruntergeritten. Oder zumindest wäre er das jeweils gerne, aber das arme Eseli war einfach immer krank. Es war wie verhext: Immer genau am 6. Dezember hat das Eseli den «Pfnüsu» oder Fieber gekriegt und der arme Chlous musste seinen Sack selber buckeln.
Heute weiss ich, wieso der Herr Graf am 6. Dezember nie da war, als der Samichlous kam und heute weiss ich auch, dass das Eseli gar nicht wirklich krank war. Eigentlich möchte ich es aber gar nicht wissen.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="41f105ae-21d0-488d-9ea3-2cf7180e1e7e" data-langcode="de"></drupal-entity> |
| Der bärtige Odin reitet auf Sleipnir. Bild: Edda, 1908. Illustration: W.G. Collingwood |
Der schleifende Sleipnir
Die alten nordischen Völker glaubten auch an einen Samichlous. Odin hiess er und war der Göttervater der nordischen Mythologie. Und schon bei ihnen kam er jeweils im Dezember vorbei und brachte Geschenke vorbei. Aber nur, wenn man seine Schuhe vor die Tür stellte und mit Karotten und Brotstückchen füllte. Und dazu Hafer bereitstellte. Nicht für das Eseli, sondern für Sleipnir, Odins achtbeiniges Pferd. Auf Sleipnir (oder übersetzt «Schleifner») konnte Odin zu Lande, zu Wasser und in der Luft «schleifen», also dahingleiten. Ein Weihnachtsmann, der durch die Luft gleitet? Das erinnert uns doch an etwas. Aber dazu später.
Bei den Germanen gab es den Odin auch. Nur hiess er dort Wuden, Wodan oder – heute am bekanntesten – Wotan. Und auch er brachte Geschenke, was bis heute in einem Thüringer Nikolausvers festgehalten ist:
«Wer kommt denn da geritten?
Herr Wude, Wude Nikolaus!
Laß mich nicht lang bitten
und schüttle deinen Beutel aus.»
Rudolf war nicht dabei
Von Sleipnir zum Schlitten ist es nicht weit. Gleicher Wortstamm, gleiches Durch-die-Lüfte-Gleiten. Und von Odin über Nikolaus zum Weihnachtsmann ist es auch nicht weit. Während bei uns der Samichlous Anfang Dezember mit dem Esel vorbeikommt, rauscht er in Amerika mit seinen Rentieren zu Weihnachten über die Städte und bringt seine Geschenke durch den Kamin in die Stuben braver Kinder.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="5ef16042-2c38-4c47-afce-214cffbb906d" data-langcode="de"></drupal-entity> |
| * Na, Sie wissen schon, was ich meine... Bild: fotumania!/Flickr |
Dieser Mythos wurde ursprünglich aus Europa in die USA eingeflogen, hauptsächlich aus den Niederlanden. Der «Sinterklaas», also der heilige Nikolaus, wurde zum «Santa Claus» und erhielt nach und nach all die Eigenschaften, die wir heute aus Film und Fernsehen kennen: Sein Aussehen wurde massgeblich von einer nicht unbekannten Getränkemarke* mitgeprägt und die Rentiere stammen aus einem Gedicht von 1823. Und nein! Rudolf gehört nicht dazu. Das berühmte Rotnasen-Rentier wurde dem Weihnachtsmann erst 1939, in einem anderen Gedicht, zugeschrieben. 1823 hiessen die Rentiere:
«More rapid than eagles his coursers they came,
And he whistled, and shouted, and call'd them by name:
‹Dasher! Now, Dancer! Now, Prancer, and Vixen!
On, Comet! On, Cupid! On, Donder and Blitzen!›»
Zum ganzen Gedicht
Wurzeln in der Türkei
Andere Völker, andere Sitten. Aber zurück zu unserem Samichlous und seinem Eseli. Der heilige Nikolaus von Myra lebte ums Jahr 300 n. Chr. in der heutigen Südtürkei, nahe Antalya. Zu Lebzeiten war er der Bischof von Myra und machte sich mit allerhand Wundern einen Namen. Nach seinem Tod (am 6. Dezember eines Jahres zwischen 326 und 365) wurde er heiliggesprochen und gilt seither als Schutzpatron der Seefahrer, Rechtsanwälte, Apotheker, Diebe, Studenten – und der Kinder. Sein Todestag wurde als Feiertag ausgerufen, in Osteuropa nimmt er bis heute Platz drei in der Heiligen-Rangliste ein – hinter Jesus und Maria.
Während der Reformation wurde dann die Heiligenanbetung abgeschafft. Sankt Nikolaus überlebte aber auch bei den Protestanten. Nicht als heiliger, aber als weltlicher Geschenkebringer. Er musste einfach Mitra und Bischofsstab abgeben und zog sich stattdessen eine Zipfelmütze über den Kopf und einen rot-weissen (oder grün-braunen) Mantel an.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="d4ac2ed8-f81c-4077-a556-32e034b157db" data-langcode="de"></drupal-entity> |
| Diese Skulptur steht im Geburtsort des Heiligen Nikolaus, in Demre. Bild: Hippolyte/wikimedia.org/CC-BY-SA |
Das Eseli, mit dem der Samichlous hierzulande gerne unterwegs ist, gibt uns einen Hinweis auf seine Südeuropäische Herkunft. Der Esel war und ist in den Ländern am Mittelmeer ein wichtiges und oft verwendetes Transportmittel. Es liegt halt einfach auf der Hand, dem türkischen Chlaus ein Eseli zur Hand zu geben. Es wäre schliesslich nicht ganz glaubwürdig, Kinder in Südeuropa mit einem Rentierschlitten zu besuchen.
Aber auch die Zipfelmütze ist nicht einfach ein Einfall findiger Marketing-Strategen, sondern ein Wink in die Türkei. Genauer: Nach Phrygien. Die Phrygische Mütze, wie sie der Samichlous trägt, stammt nämlich von dort. Und ihre Entstehungsgeschichte ist interessant.
Der sagenhafte König Midas wurde nämlich aufmüpfig gegen den Gott Apollo. Er widersprach ihm in einem musischen Wettstreit. Als Strafe dafür verpasste ihm Apollo ein Paar Eselsohren. Und um die zu verstecken, liess sich Midas eine besonders hoch gezipfelte Mütze schneidern.
Und noch heute tragen die Samichläuse und Weihnachtsmänner – und sogar Gartenzwerge – diese Phrygische Mütze. Und wenn die Legende wahr ist und sie darunter wirklich etwas zu verstecken haben, war vielleicht an all jenen sechsten Dezembern doch zumindest ein kleines Bisschen Eseli bei mir im Quartier, als Herr Graf vorbeikam.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


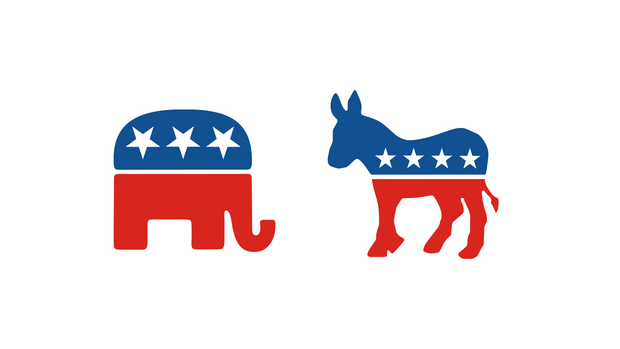







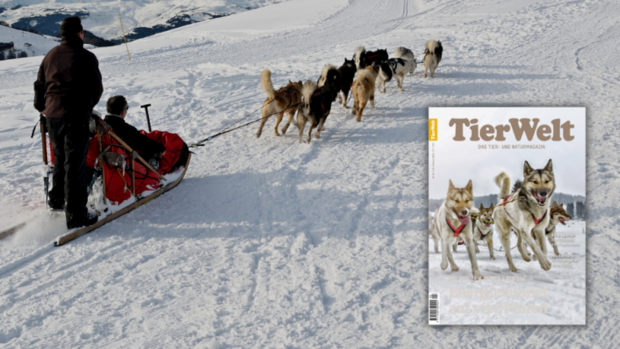


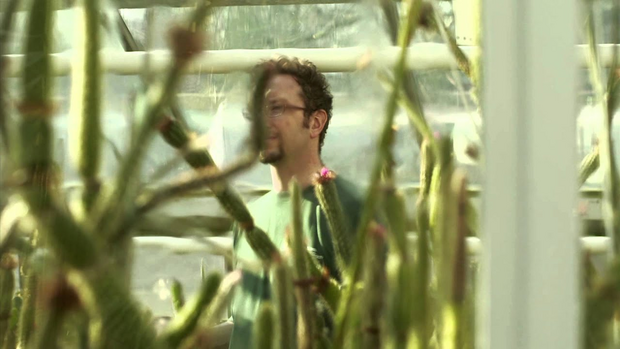

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren