«Findet Dorie»
Meeresabenteuer mit Tiefgang
«Findet Nemo» war der Klassenschlager des Jahres 2003. Der Animationsfilm mit dem herzigen Anemonenfisch in der Hauptrolle erhielt sogar einen Oscar. Nun startet in den Kinos die Fortsetzung: «Findet Dorie» überzeugt mit einer tollen Botschaft.
Unglaubliche 13 Jahre ist es jetzt her, dass der kleine, animierte Anemonenfisch Nemo sich in die Herzen eines weltweiten Millionenpublikums schwamm. Seine rührende Geschichte liess nicht nur die Kinokassen klingeln, sondern sorgte auch für eine gigantische Nachfrage nach Anemonenfischen, besser bekannt als Clownfische. Plötzlich wollten ganz viele Kinder einen «Nemo» als Haustier, sodass die Fangquote für den orange-schwarz-weissen Meeresbewohner im Jahr 2004 massiv erhöht wurde. Auch die in «Findet Nemo» vorkommende australische Ostküste wurde in dieser Zeit von Touristen überschwemmt.
Angesichts dieser gewaltigen Euphorie ist es erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis eine Fortsetzung des Animationsfilms auf die grosse Leinwand kommt. Nun ist es aber endlich so weit: Nemo ist zurück, spielt aber nicht mehr die Hauptrolle. In diese schlüpft dieses Mal der weibliche Paletten-Doktorfisch Dorie.
Handicaps hindern nicht
Die blaue Dame ohne Kurzzeitgedächtnis lebt inzwischen glücklich und zufrieden mit Nemo und dessen Vater Marlin in einem Korallenriff, als sie einen Geistesblitz hat: Irgendwo da draussen müssten doch ihre Eltern sein. Also macht sich Dorie mit Marlin und Nemo auf eine abenteuerliche Suche, die sie durch den Ozean bis zum berühmten Meeresbiologischen Institut in Kalifornien mit seinem Aquarium und seiner Rettungsstation für Meerestiere führt.
Das ehrgeizige Unterfangen wäre jedoch schnell zum Scheitern verurteilt, wenn Dorie nicht auf die Unterstützung wertvoller Helfer setzen könnte: Da wären zum Beispiel der Oktopus Hank, der nur noch sieben Tentakel hat; der Beluga Bailey, dessen Echolot nicht mehr funktioniert; das Walhai-Weibchen Destiny, das fast blind ist und die Seetaucher-Dame Becky, die arg verwirrt ist.
All diese Tiere vereint, dass sie auf unterschiedliche Weisen gehandicapt sind, genau wie die Hauptfigur Dorie mit ihrer Vergesslichkeit. Dass sie sich deshalb nicht davon abhalten lassen, Gutes zu tun und versuchen, ihre Ziele zu erreichen, ist eine lobenswerte und gelungene Botschaft des Films. Der Zuschauer bekommt diese nämlich weder penetrant-aufdringlich noch tränenreich-kitschig serviert, was der Bekömmlichkeit äusserst guttut.
Diese ernste Komponente ist auch der grösste Unterschied zu «Findet Nemo», was dem Regisseur Andrew Stanton wichtig war: «Diesmal zeigen wir, dass Dories schlechtes Gedächtnis nicht nur lustig, sondern ein ernstes Problem für sie darstellt. Dorie ist zwar immer munter und fröhlich, aber tief drinnen hat sie Angst vor dem, was passieren könnte, wenn sie mal wieder alles vergisst.» Da sich die Paletten-Doktorfisch-Dame aber ihrer Defizite bewusst ist, tritt sie auch anderen gegenüber ohne Vorurteile auf. Sie akzeptiert jeden so, wie er ist.
Das lange Warten hat sich gelohnt
Bei aller Ernsthaftigkeit und dem Vorbildcharakter des Animationsfilms bleibt aber auch der Spass nicht auf der Strecke. Vor allem Oktopus Hank ist zum Brüllen komisch und trotz seiner mürrischen Art liebenswert. Herausragend ist zudem die perfekte Optik der Unterwasserwelt. Die Lichtgestaltung ist genial, ebenso wie die detaillierte Darstellung der Tier- und Pflanzenwelt. Selbst, wenn man den Film nicht in 3-D schaut, hat man das Gefühl, unter Wasser zu tauchen.
So bleibt am Ende nur eine Frage offen: Warum heisst der Film «Findet Dorie», obwohl Dorie die ganze Zeit ihre Eltern sucht? Viel wichtiger, als das Sinnieren über diese Logiklücke, ist aber die Feststellung, dass sich das 13 Jahre lange Warten auf die Fortsetzung von «Findet Nemo» gelohnt hat. Sehr sogar.
«Findet Dorie», Animationsfilm, 103 Minuten, Verleih: Disney, ab sofort im Kino.
[IMG 2]
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


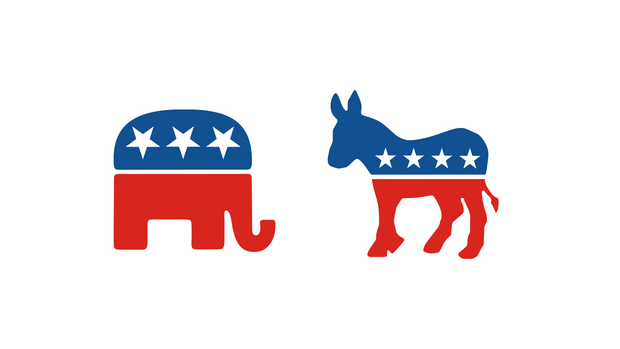












Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren