Krytopzoologie
Nessie, Yeti, Bigfoot: Das Archiv der Fabelwesen
Gibt es Yeti, Bigfoot oder Nessie? Kryptozoologen hoffen es sehr – und suchen unverdrossen nach Belegen dafür. Die grösste Sammlung mit Hinweisen auf solche Fantasiegestalten lagert in Lausanne.
Hoch über der Place Riponne, im obersten Stock des Lausanner Museumspalastes, liegt so etwas wie der Heilige Gral aller Yeti-, Nessie- und Bigfoot-Fans: das Heuvelmans-Archiv. 50 Jahre seines Lebens verbrachte der belgische Zoologe, Musiker und Autor Bernard Heuvelmans damit, Belege zu sammeln für die Existenz von fast 150 Tierarten, die fabelhaft oder fantastisch anmuten, die umstritten und unbekannt sind.
Er ging Hinweisen über Affenmenschen aus allen Regionen der Welt nach. Er suchte nach Spuren von ausgerotteten Tieren wie der Stellerschen Seekuh oder dem Beutelwolf. Und er versuchte gänzlich neue Tiere aufzuspüren wie den Bunyip in Australien und den Nandi-Bär in Kenia. Sein Wirken machte Heuvelmans zum Vater der Kryptozoologie, der Lehre von den verborgenen Tieren. Im Jahr 1999, zwei Jahre vor seinem Tod, vermachte er seine Sammlung dem Zoologischen Museum in Lausanne, weil ihm die Schweiz neutral und sicher schien.
Berichte, Fotos, Fussabdrücke
Gehütet wird Heuvelmans’ Schatz seit damals von Michel Sartori, dem Direktor des Museums. «Zum Anschauen ist es nicht gerade eine spektakuläre Sammlung», warnt er die Besucher, während er sie einen langen Gang entlangführt. In einem Zwischenräumchen stoppt er und öffnet eine schwere Tür, die den Blick freigibt in ein kleines Kämmerchen, in dem ein Dutzend mobiler Museumsregale aneinandergeschoben sind.
Sartoris Assistentin kurbelt zwei der Regale auseinander. Auf einem Gestell stehen, fein säuberlich beschriftet, ganze Reihen von Kartonboxen. «Nessie» steht auf einigen, «Sasquatch» auf anderen. Sartori nimmt eine der Boxen und öffnet sie. Vergilbte Kopien von englischsprachigen Zeitungsartikeln kommen zum Vorschein und Zeichnungen von Wesen, die halb Affe, halb Mensch zu sein scheinen. Sasquatch ist ein anderer Name für den Bigfoot. Dieses Fabeltier ist in Nordamerika derart populär, dass es in jedem US-Bundesstaat seinen eigenen Fanklub hat. Viele wollen Bigfoot schon gesehen haben, manche glauben, es handle sich um den Nachfahr von Gigantopithecus, einem riesenhaften Menschenaffen, der nachweislich bis vor einigen Hunderttausend Jahren gelebt hat.
Der Mann im Eis
Der Museumsdirektor selbst ist kein Kryptozoologe, sondern Insektenforscher. An die Existenz von Wesen wie Nessie, Yeti oder eben Bigfoot mag er nicht glauben. Aber, sagt er, man müsse Heuvelmans zugutehalten, dass er relativ wissenschaftlich vorgegangen sei. «Es gibt von diesen Tieren keine toten Exemplare, also keine direkten Beweise dafür, dass sie existieren», sagt er. «Also trug Heuvelmans Indizien zusammen: Berichte angeblicher Augenzeugen, Fussabdrücke, Fotos.»
1955, im Alter von 39 Jahren, veröffentlichte Heuvelmans das Buch «Sur la piste des bêtes ignorées» (Auf der Spur unbekannter Tiere). Es verkaufte sich über eine Million Mal und machte ihn finanziell unabhängig. Der Erfolg von Heuvelmans Forschung war allerdings überschaubarer als jener seiner Schriftstellerei. Von zwei Riesentintenfischen, deren Existenz er vorhergesagt habe, sei einer, der Riesenkalmar, tatsächlich nachgewiesen worden, sagt Sartori. «Aber sonst ...»
Heuvelmans hatte zwar viele Bewunderer und scharte in der Internationalen Vereinigung für Kryptozoologie eine ansehnliche Gruppe von Wissenschaftlern und Laienforschern um sich. Doch er wurde natürlich auch scharf kritisiert. Sein Waterloo erlebte er Ende der 1960er-Jahre, als er mit einem Kollegen in den USA auf der Suche nach Bigfoot war. Man machte ihn auf einen Schausteller aufmerksam, der in Minnesota mit einer menschenähnlichen Kreatur auf Jahrmärkten auftrat, die in einem Eisblock eingefroren war.
Heuvelmans untersuchte den «Eismann aus Minnesota», wie er genannt wurde, in einem Lastwagenanhänger. Was er sah, begeisterte ihn: Es war ein haariger Hominid mit einer flachen Nase, der offensichtlich erschossen worden war. Heuvelmans schrieb zuerst einen wissenschaftlichen Artikel, dann ein Buch, in denen er schloss, dass es sich um einen Neandertaler handle. Diese Verwandten des Menschen mussten also bis in die heutige Zeit überlebt haben. Wo? Kein Problem für den Kryptozoologen: «Der Aussteller war ein Vietnam-Veteran, also siedelte Heuvelmans den Eismann kurzerhand im dortigen Regenwald an», erzählt Sartori. «Es war haarsträubend.»
Es kam, wie es kommen musste: Als es um eine eingehende Untersuchung der Leiche ging, verstrickte sich der Schausteller immer tiefer in Widersprüche und machte sich schliesslich vom Acker; nur um später mit einem Exemplar wieder aufzutauchen, das sich eindeutig von dem Original unterschied und erst noch aus Latex gefertigt war.
Das Huhn auf dem Gemälde
Es waren nicht nur solche Fälschungen, die zum schlechten Ruf der Kryptozoologie beitrugen. In den 1980er- und 1990er-Jahren wandelten sich die Naturwissenschaften: Forschungsgelder erhielt nur noch, wer seine Ergebnisse mit harten Fakten unterlegte und in angesehenen Fachzeitschriften publizierte. Das bekam die Vereinigung der Kryptozoologen zu spüren: Bestand sie anfangs zu einem ansehnlichen Teil aus arrivierten Forschern, ging ihr nun der akademische Nachwuchs aus. «Die Jungen glaubten nicht mehr an die Methoden der Kryptozoologen – oder sie konnten sich eine Mitgliedschaft nicht leisten, ohne ihre Forschungskarriere zu gefährden», sagt Sartori.
Und doch: Neue, spektakuläre Entdeckungen im Tierreich wurden immer wieder gemacht – und werden es noch heute. 1901 kam die westliche Welt einem zentralafrikanischen Waldbewohner auf die Spur, den die dortigen Bantu-Stämme schon lange gekannt hatten: dem Okapi. 1912 beschrieb der Direktor einer zoologischen Sammlung in Indonesien eine über drei Meter lange Echse, den Komodowaran. 1938 entdeckten Forscher vor der Küste Südafrikas den Quastenflosser, einen eigentümlichen Fisch, von dem man bis dahin geglaubt hatte, er sei längst ausgestorben. Und 1993 sorgte die Beschreibung des Saola, eines Waldrindes in Vietnam, für Furore unter Fachleuten.
Sartori kennt all diese Entdeckungen. Doch er fragt: «Sind das Funde, die dank der Kryptozoologie gemacht wurden?» Laut ihm zeigen solche Beispiele, dass spektakuläre neue Tierarten auch ohne Heuvelmans Methoden aufgespürt werden können. Andererseits sei es aber auch so, dass eine seriös betriebene Kryptozoologie durchaus ihre Berechtigung habe. Als Beispiel nennt Sartori den Koau, eine Purpurhuhnart, die bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Insel Hiva Oa in Französisch-Polynesien überlebt hatte. Auf die Schliche kam ihm ein Kryptozoologe, der den Vogel auf einem Gemälde entdeckte, das der Maler Paul Gauguin 1902 gemalt hatte.
Eisbären im Himalaja?
Nach dem Tod Heuvelmans’ versank die Kryptozoologie weitgehend in der Bedeutungslosigkeit. In Lexika wird sie unter dem Begriff «Pseudowissenschaft» geführt und die Internationale Vereinigung für Kryptozoologie ist seit 2004 nicht mehr aktiv. Trotzdem glaubt Sartori nicht, dass die umstrittene Disziplin verschwinden wird. «Die Kryptozoologie wird eine Randwissenschaft bleiben», sagt er. «Aber Geschichten über Schneemenschen oder Seeungeheuer werden die Fantasie der Menschen weiterhin beflügeln.»
Daran wird auch die viel beachtete Studie über Yeti und Bigfoot nichts ändern, an der Sartori vor einigen Jahren selbst beteiligt war. Gemeinsam mit Kollegen aus Grossbritannien und den USA untersuchte er mit neuen genetischen Methoden 30 Haarproben, die eigentümlichen Primaten aus Nordamerika und Asien zugeschrieben worden waren. Die Resultate waren eindeutig: Die Haare stammten allesamt von bekannten Tierarten: von Bären, Pferden, Kühen, Hundeartigen, ja sogar von Waschbären und Stachelschweinen.
Für Aufregung sorgten einzig zwei Proben aus dem Himalaja: In einer ersten Fassung ihrer Publikation ordneten die Forscher sie genetisch einer längst ausgestorbenen Population von Eisbären zu. Das stellte sich aber als falsch heraus. «Einer der Mitautoren hatte sich beim Vergleich unserer Gensequenzen mit den entsprechenden Datenbanken geirrt – es handelte sich um das Erbgut von heutigen Eisbären», sagt Sartori. Das bedeute allerdings nicht, dass im Himalaja Eisbären gefunden worden seien. Denn das untersuchte Erbgut stammt aus ganz bestimmten Zellorganellen, sogenannten Mitochondrien, und wird nur mütterlicherseits vererbt.
Es könnte also sein, spekuliert Sartori, dass in einer früheren Eiszeit im Himalaja Eis- und Braunbären aufeinandertrafen und sich miteinander verpaarten. Einige Braunbären in dem Gebirge trügen demnach die Spuren dieser Hybridisierung noch heute in ihrem Erbgut. Er auf jeden Fall sei überzeugt, dass es sich bei Yeti um einen Bären handle, sagt Sartori.
Der Yeti-Helm in der Vitrine
Der Museumsdirektor legt die Fotos und die Kopien nun wieder in die Anonymität der Kartonbox zurück. Wobei: Heuvelmans’ Sammlung steht Interessierten für Forschungszwecke offen. Das werde auch immer wieder genutzt, sagt Sartori. Nicht etwa von naiven Yeti- oder Nessiesuchern, sondern von seriösen Wissenschaftlern. So habe zum Beispiel der renommierte Wissenschaftsjournalist Richard Stone in dem Archiv drei Tage lang Dokumente für ein Buch über Mammuts gesucht – und gefunden, sagt Sartori.
Gewöhnliche Besucher finden im Zoologischen Museum nur eine einzige Vitrine, die der Kryptozoologie gewidmet ist. Das liege schlicht daran, dass im Museum momentan niemand arbeite, der sich in der Materie genügend gut auskenne, sagt Sartori, während er die Besucher zu dem Schaukasten führt. Hinter der Glasscheibe ist die Zeichnung eines Schnee- oder Waldmenschen aufgehängt, davor stehen zwei Gegenstände: das plastifizierte Armstück eines Riesentintenfischs – und eine Art Helm, der Yeti zugeschrieben wird. Über die Kopfbedeckung läuft ein Haarkamm, der an eine Punkfrisur erinnert. Als der Journalist wissen will, ob er das Erbgut dieser Haare ebenfalls untersucht habe, nickt Sartori und lächelt leise. «Pferd», sagt er.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


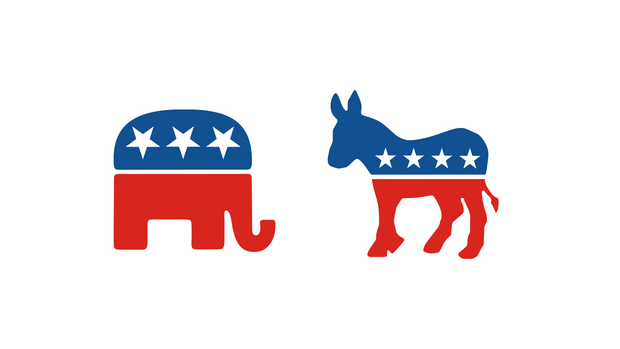











Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren