Fokus
Wann ist ein Wolf ein Wolf?
Sowohl Kinder als auch Erwachsene mögen Tiergeschichten in Büchern – oder auch nur Vögel auf Buchdeckeln. Oft wollen wir nur unterhalten werden. Aber auch wir können von Katzenkrimis & Co. lernen.
Irgendwann waren sie einfach da. Eroberten sich ihren Platz in den Regalen der Buchhandlungen und gaben ihn bis heute nicht mehr her: Katzenkrimis. Mehr als ein Dutzend Autorinnen und Autoren lassen ihre Samtpfoten regelmässig auf Verbrecherjagd gehen. Das Konzept ist simpel und fast immer dasselbe: Der Detektiv, der auf ein Verbrechen angesetzt wird, ist von seiner Aufgabe überfordert, löst den Fall aber letztlich dank der Unterstützung der Katze.
Die Nische der Katzenkrimi-Liebhaber mag klein sein, aber offenbar verkaufen sich diese Geschichten so gut, dass sich daraus ein eigenes Literaturgenre entwickeln konnte. «Katze Blümchen ermittelt», heissen die Krimis beispielsweise, «Sechs Katzen und ein Todesfall» oder «Katzen, Killer und Kakteen». Es gibt zwar auch Hundekrimis, Schweinekrimis oder Schafkrimis («Glennkill» war 2005 mitverantwortlich für den Aufstieg dieser Tierkrimis), Büsi bleiben aber bis heute die bei Weitem häufigsten Titelhelden solcher Bücher.
Dabei geht es in der Literatur sonst deutlich häufiger um unser anderes Lieblingshaustier – um den Hund. Kein Wunder, denn der Hund tut, was wir von ihm verlangen. Wer ein Buch schreibt, muss sich tief in die Gefühle, Gedanken und Handlungen seiner Protagonisten hineinversetzen. Ist der Protagonist ein Tier, ist das schon mal kompliziert, doch was ein gut erzogener Hund tut und denkt, können wir allemal besser nachvollziehen, als was sich im Kopf einer Katze abspielt.
Von den Buchdeckeln zwitschert es
Wer aktuell durch Schweizer Buchhandlungen streift, dem fallen nicht nur die Katzenkrimis auf. Auch sonst sind Tiere auf Buchtiteln allgegenwärtig. Gerade in der Liebesroman-Abteilung, so könnte man meinen, geht es animalisch zu und her. Dabei kommen Tiere in der Handlung dieser Erzählungen meist gar nicht vor.
«Weil wir Flügel haben» heisst etwa eins dieser Taschenbücher. Darauf zu sehen ist ein blaues Vögelchen auf einem Ast. Mit der Handlung hat es kaum etwas zu tun. Genauso wenig die Rosaflamingos auf dem Cover von «Mit Hanna nach Havanna». Und «Die Nachtigall» ist sogar nach dem Vogel auf dem Titelbild benannt, handelt aber von einer jungen Frau, die im Krieg über die Pyrenäen flüchten muss – über den sogenannten «Pfad der Nachtigall».
Wieso jedoch überall Vögel auf Buchdeckeln sitzen, mit denen sie gar nichts zu tun haben, ist schnell erklärt: Wir Erwachsenen funktionieren genau gleich wie unsere Kinder (siehe Seite 16). Und die Meisen und Tauben auf unseren Buchcovers sind dasselbe wie die Hasen, Füchse und Mäuse in den Bilderbüchern der Kleinen: Sinnbilder.
Zwar versetzen wir uns während des
Lesens nicht in die Lage des Vogels, wohl aber erlaubt uns das Titelbild, uns unsere Helden selbst auszumalen. Wären Menschengesichter auf dem Buchdeckel, wäre unsere Fantasie beschnitten. Uns würde aufgezwungen, wie wir uns die Buchfiguren vorzustellen haben; wir könnten genauso gut einen Film schauen.
Menschen sind deshalb auf Umschlagseiten von Romanen kaum je zu sehen, höchstens mal von hinten. Dafür sind Strände und Wälder, Blumen und Bäume hoch im Kurs. Und eben Tiere: Vögel, Pferde und – der absehbare Renner bei Liebesgeschichten – Schmetterlinge.
Höchstens eine Annäherung
Die Literaturwissenschaft interessiert weniger, was auf Buchdeckeln abgebildet ist und mehr, was in der Handlung passiert. Literary Animal Studies nennt sich der Fachzweig, der sich eigens der Erforschung von Tieren in der Literatur verschrieben hat. Er versucht, zu ordnen und zu gliedern, ein theoretisches Fundament zu schaffen, das es künftigen Forschern erleichtert, Texte auf ihre Tier-Inhalte zu untersuchen. Ein schwieriges Unterfangen.
Roland Borgarts ist einer der führenden Literaturwissenschaftler, wenn es um Tiere geht. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Frankfurt und Herausgeber von «Tiere – Kulturwissenschaftliches Handbuch». Darin handelt er auf zwanzig Seiten den aktuellen Stand der Forschung ab. Und grenzt zunächst einmal ab: «Wortwölfe können uns Lesende nicht beissen; und umgekehrt können wir als Lesende sie nicht töten.»
Die Kernaussage, die er damit machen will: Wenn wir in einem Buch etwas über ein Tier lesen, macht dies das Tier noch nicht «echt» oder «lebendig». In der Erwachsenenliteratur werden Tiere zwar seltener vermenschlicht als in Kinderbüchern, aber ganz Tier ist das Tier auch dort nie. Ein Autor kann sich seiner wahren Natur höchstens annähern. Jean de
La Fontaine beschreibt in seinen Fabeln den Wolf wohl weniger naturgetreu als Rudyard Kipling im «Dschungelbuch». Trotzdem dichten beide Autoren ihren Wölfen eine menschliche Sprache an.
Doch auch Tiere, die sich tatsächlich wie
Tiere verhalten, tun das eben nur mehr oder
weniger. In Frank Schätzings «Der Schwarm» etwa können die Tiere zwar nicht reden, kriegen aber vom Autor seine Idee aufgedrängt. Ja sogar ein Sachbuch oder ein Lexikoneintrag zeigen ein vom Menschen geprägtes Bild von Tieren. Deutlich macht das etwa ein Blick auf «Brehms Tierleben» aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Im Eintrag über den Wolf schreibt Alfred Brehm etwa: «Im vorigen Jahrhunderte fehlte das schädliche Raubtier keinem grösseren Waldgebiete unseres Vaterlandes.» Aus dieser Wertung spricht der Mensch, nicht der Wolf.
Die Verantwortung des Autors
In der Tierliteratur geht es also immer in erster Linie um den Menschen und erst in zweiter ums Tier. Und doch ist sie seit jeher ein machtvolles Instrument, das Tieren zu Leid, aber auch zum Wohl verhelfen kann. Brehms Lexikoneintrag hat dem Ruf des Wolfes zu seiner Zeit mit Bestimmtheit geschadet und wohl mit zu seiner Ausrottung im deutschsprachigen Raum beigetragen. Genauso im Märchen vom Rotkäppchen der Brüder Grimm, das heute jedem Kind Schauder und Vergnügen bereitet. «Tiere, die Grossmütter und Enkeltöchter fressen, dürfen und sollen ausgerottet werden», analysiert Literaturwissenschaftler Roland Borgarts.
Bücher können Tieren aber auch Gutes tun. In ferner Vergangenheit waren sie oft die einzige Informationsquelle über exotische Tiere und ermöglichten den Lesern Momente des Staunens und der Verwunderung.
Romane über treue Hundeseelen und tapfere Kriegspferde lassen unsere Bindung zu diesen Tieren nur stärker werden und feinfühlige Berichte über bedrohte Arten mahnen uns vielleicht daran, Sorge zu unserem Planeten zu tragen. Und Katzenkrimis schliesslich tragen dazu bei, unsere launischen und eigensinnigen Fellknäuel als ganz kluge Köpfchen wahrzunehmen.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


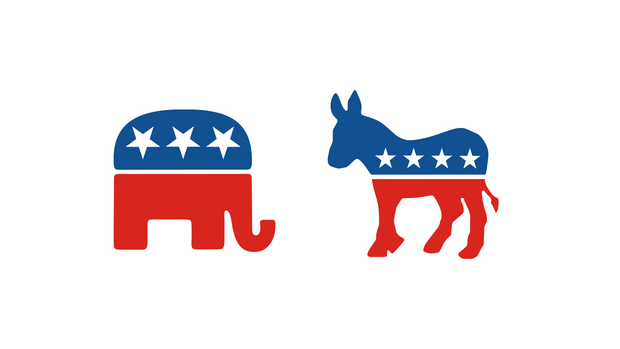












Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren