Wilihof
Hirsche statt Kühe: Familie Gafner setzt in Wilihof auf nachhaltige Wildtierhaltung
Auf einem Hof im luzernischen Wilihof grasen keine Kühe oder Schafe, sondern Damhirsche. Familie Gafner setzt auf nachhaltige Wildtierhaltung – und trifft damit den Geschmack der Zeit.
Wer an Bauernhöfe denkt, der hat meist Kühe, Hühner oder Schweine vor Augen. Doch auf dem Hof der Familie Gafner im luzernischen Wilihof grasen Tiere, die eher an einen Wildpark erinnern: Damhirsche beobachten Besucher des Hofs argwöhnisch aus der Distanz, gut geschützt hinter einem zwei Meter hohen Zaun. «Wer mit der Hoffnung kommt, einen Hirsch streicheln zu können, der wird leider enttäuscht», bemerkt Deborah Gafner. Sie leitet zusammen mit ihrem Partner den Hof, den sie von ihren Eltern übernommen hat. Vater Markus Gafner hat sich 2004 für eine Damhirschhaltung entschieden.
[IMG 2]
Zuvor lebte der Betrieb von Kühen, Schweinen und Tabak. «Irgendwann hätten wir aber aufstocken müssen – schon rein aus finanziellen Gründen – und dafür reicht der Platz bei uns schlicht nicht», begründet der Pensionär seine Entscheidung. Gleichzeitig wollte die Familie ihren Gästen etwas Besonderes bieten, denn sie bewirtet auf dem Hof geschlossene Gesellschaften mit lokalen Spezialitäten. «Auf einem typischen Bauernhof riecht es nach Mist, was den einen oder anderen Schankgast stört. Mit Damhirschen haben wir dieses Problem nicht», so Markus Gafner.
Keine ReheReh gehört nebst Hirsch und Wildschwein zu den beliebtesten Wildfleischarten. Allerdings eignet sich die Art nicht für eine Gatterhaltung, da Rehe territorial sind und entsprechend mehr Raum brauchen als Rot- oder Damhirsche. Letztere leben auch in freier Wildbahn in Rudeln und lassen sich daher auf vergleichsweise kleinem Raum halten.
Jenseits der Jagd
Damhirsche stammen ursprünglich aus Vorderasien, wurden aber bereits während des Römischen Reiches in viele Regionen Europas eingeführt. Ab dem 16. Jahrhundert haben sie zudem viele Fürste und Grossgrundbesitzer als Gattertiere importiert, um sie jagen zu können. Ihr Fleisch ist es auch, welches Damhirsche hierzulande beliebt macht. Denn im Herbst überkommt Herr und Frau Schweizer die Lust auf Wild. Knapp3900 Tonnen Wildfleisch gingen 2024 in der Schweiz über die Theken und auf die Teller – rund 400 Gramm pro Einwohner. Der Wildfleischkonsum ist seit Jahren rückläufig. Was bleibt, ist die Tatsache, dass rund zwei Drittel des Wilds importiert sind. «Die Nachfrage nach Schweizer Wildfleisch steigt», so Markus Gafner. Die Jagd allein kann diesen Bedarf nicht decken, schon gar nicht zu kundenfreundlichen Preisen. So greifen viele Schweizerinnen und Schweizer auf Fleischprodukte von Hirschen zurück, die in Gehegen gehalten werden.
Seit 1993 sind Hirsche als landwirtschaftliche Nutztiere in der Schweiz anerkannt. Der Damhirsch gilt dabei als die einfachste zu haltende Art, da er in grossen Herden in parkähnlichen Landschaften lebt und in der Grösse zwischen einem Reh und einem Rothirsch anzusiedeln ist. «Auf den fünf Hektaren Weide leben aktuell 70 Damhirsche in einer friedlichen Gruppe», erzählt Deborah Gafner. Darunter befinden sich lediglich zwei Böcke: der dominante Platzhirsch und ein einjähriger Spiesser. «Er sorgt dafür, dass der ältere Bock nicht faul wird», erklärt Gafner mit einem Augenzwinkern. Im Frühling kommen jeweils 30 bis 35 Jungtiere zur Welt. Noch am Tag ihrer Geburt werden sie von den Gafners mit einer Ohrmarke versehen und ins Herdenbuch eingetragen.
[IMG 3]
Im September, wenn die Tiere des Vorjahres ein Gewicht von 50 bis 80 Kilogramm erreicht haben, werden sie geschossen. «Dabei teilen wir die Herde in kleine Gruppen ein und leiten diese in einen abgetrennten Bereich. Aus einem Versteck heraus schiesse ich dann die einzelnen Tiere», erzählt Markus Gafner. «Die restliche Herde erschreckt sich zwar kurz wegen des Schussgeräusches, frisst aber jeweils schnell wieder weiter», berichtet Gafner. Trotzdem schiesst er während der Saison pro Tag jeweils nur etwa fünf Tiere, nicht zuletzt auch, um den Metzger nicht zu überfordern, denn die Tiere müssen danach fachgerecht ausgenommen und zerlegt werden. Vor dem Abschuss erfolgt eine Lebendschau durch einen Veterinär, danach wird jedes geschossene Tier auf Hämatome, Leberegel, Lungenwürmer und andere Auffälligkeiten untersucht. «Bisher gab es noch nie etwas zu beanstanden», sagt Deborah Gafner nicht ohne Stolz, denn die Familie investiert viel Zeit und Herzblut in die Haltung ihrer Hirsche.
Tierhaltung mit Hürden
Hirsche gelten auch in der Landwirtschaft als Wildtiere. Wer sie halten möchte, braucht eine entsprechende Bewilligung und eine spezifische Ausbildung, zum Beispiel den von der Branchenorganisation Agridea angebotenen Sachkundekurs. Die Weidefläche muss gross genug sein, um das ganze Jahr hindurch ausreichend Gras für die Tiere zur Verfügung stellen zu können. Deborah und Markus Gafner haben das Gehege dafür in mehrere Sektoren unterteilt, zwischen denen die Damhirschherde in regelmässigen Abständen umzieht, damit das Gras im eben beweideten Teil nachwachsen kann. «Im Herbst fressen die Tiere zudem das Fallobst der Bäume auf der Weide», ergänzt Deborah Gafner. Im Winter wird Emd sowie Gras- und Maissilage zugefüttert, alles aus hofeigenem Anbau. Dafür hat sich die Familie Gafner auch eine Auszeichnung mit der Bioknospe verdient. Dass der Hof die entsprechenden Voraussetzungen eines Biobetriebs erfüllt, wird einmal im Jahr kontrolliert. Hinzu kommt die zweijährliche Kontrolle des Veterinäramts. Da Damhirsche scheu sind und sich nicht so einfach untersuchen lassen, sammelt Markus Gafner zudem viermal im Jahr den Kot der Tiere ein, um diesen am Forschungsinstitut für biologischen Landbau untersuchen zu lassen.
[IMG 4]
Die Mühe zahlt sich aus. Die Besucher des Hofes können sich an einer gesunden Herde aus stattlichen Hirschen erfreuen, die gemütlich äsend unter den schattigen Bäumen stehen. Nebst Bio-Wildfleisch ist es für Hirschliebhaber zudem möglich, ein besonderes Souvenir vom Hof zu erstehen: ein Damhirschgeweih. Jedes Jahr im Frühling werfen die Männchen ihre schaufelförmigen Geweihstangen ab. «Innerhalb von rund 100 Tagen wächst dann ein komplett neues Geweih nach», sagt Deborah Gafner. «Mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von über zwei Zentimetern pro Tag ist es das schnellst wachsende Körperteil im Tierreich.»
Sie findet die Stangen mit etwas Glück irgendwann beim täglichen Besuch des Hirschgeheges. Deborah Gafner hat vor Kurzem den Hof ihrer Eltern übernommen und will auch die Hirschhaltung weiterführen. Um deren Zukunft muss sich die 32-Jährige keine Sorgen machen, denn die Bestellliste für Entrecôte, Geschnetzeltes und Würste von Biohirschen ist auch dieses Jahr bereits wieder voll.
Damhirsch auf AbwegenMit einer Mindesthöhe von zwei Metern ist ein Damhirschgehege praktisch ausbruchsicher. Sollten durch ein Loch im Zaun trotzdem einmal Tiere entkommen, ist schnelles Handeln gefragt. Damhirsche gelten als Neozoen und können in freier Wildbahn unvorhersehbare Schäden anrichten. Daher ist eine Etablierung wildlebender Rudel aus entwichenen Gattertieren unerwünscht. Sollten alle Einfangversuche scheitern, werden freilaufende Damhirsche durch die Behörden in der Regel zum Abschuss freigegeben.











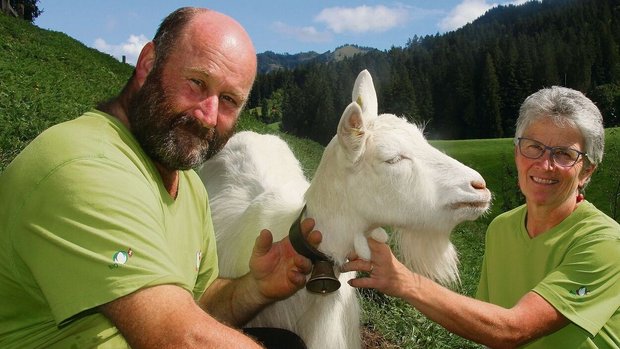







Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren