Zuchtprojekt
Das moderne Hausschwein
Als es noch keine Hochleistungsrassen gab, galten Schweine als ideale Resteverwerter. Das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) macht sich zusammen mit innovativen Betrieben auf die Suche zurück zur lokal gedachten Schweinehaltung.
Um den extrovertierten und kontaktfreudigen Berkshire-Eber Harry herum hat Florian Schweer keine ruhige Minute. Kaum hört der Landwirt auf, die borstige Haut des Schweins zu kratzen, trampelt ihm der Eber fordernd hinterher. «Er schätzt den Kontakt und die Nähe», meint Schweer mit einem nachsichtigen Lächeln. Einen ganz anderen Charakter sei Harrys Zuchtpartnerin der Rasse Wollschwein. «Lisa ist sensibel und eher zurückhaltend», verrät Schweer. Er verspricht sich einiges von der Kreuzung der beiden Rassen. «Wir haben schon seit Jahren Wollschweine und sind zufrieden mit ihnen.» Das einzige Manko: Sie setzen viel Fett an, was nicht mehr so gefragt ist wie einst. «Die Leute wollen heute Magerfleisch», so Schweer. «Wir wünschen uns Schweine, die gleich robust, sozial und umgänglich sind wie das Wollschwein.» Allerdings müssen sie auch rentabel sein, da die Wollschweine etwas sehr langsam zunehmen, so der innovative Landwirt. Auch diesen Nachteil könnten die Berkshire-Schweine vielleicht…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.














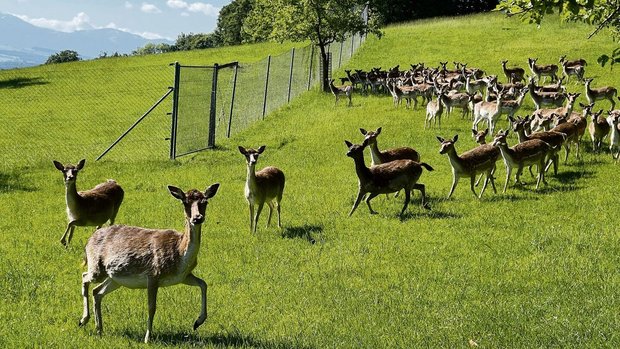







Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren