Hühnerhaltung
Hahn im Korb? Warum die Haltung eines Güggels Chancen und Risiken mit sich bringt
Ob in der privaten oder der gewerblichen Hühnerhaltung: Der Hahn hat oft das Nachsehen. Warum das so ist und was dagegen unternommen wird.
Dass auf dem Hühnerhof Schigu nur Hennen, aber kein Hahn gehalten werden, ist kein Einzelfall. Geht es um die private Hühnerhaltung, betonen das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und der Schweizer Tierschutz (STS) im Ratgeber «So halten Sie Hühner richtig», dass der Güggel für eine sozial stabile Gruppe nicht unbedingt erforderlich sei. Bestehe der Wunsch dennoch, empfehle sich ein Hahn in einer Gruppe von zirka fünf Hühnern. «Allerdings können Hähne aggressiv und sehr laut sein», geben STS und BLV zu bedenken. «Zwei Hähne in einer Gruppe können je nach Platzangebot zu Problemen führen.»
Tatsächlich sorgt gerade die Lautstärke des typischen «Kikeriki» eines Güggels immer wieder für Diskussionen. Mit Krähen legen Hähne los, sobald sie geschlechtsreif sind – also mit vier oder fünf Monaten. Ihr Schrei dient der Reviermarkierung, als Warnsignal oder eben auch als Weckruf.
Morgens kräht der Hahn, um den neuen Tag einzuläuten. Dass sie beim ersten Tageslicht damit beginnen, ist jedoch ein Irrglaube. Forschende haben anhand eines Experiments herausgefunden, dass Güggel eine innere Uhr haben: Sie krähen morgens zuverlässig, auch wenn sie im Dunkeln gehalten werden – also bereits vor den ersten Sonnenstrahlen.
Zu welcher Uhrzeit auch immer: Das «Kikeriki» eines Güggels ist nur schwer zu überhören. Direkt neben dem Schnabel wurden schon Hahnenschreie gemessen, die bis zu 142 Dezibel laut sind. Das entspricht etwa einem startenden Jet in rund 50 Metern Entfernung oder einer abgefeuerten Schusswaffe in unmittelbarer Nähe.
Güggel gewinnt vor Gericht
Schon fast selbstredend, dass es in der Nachbarschaft rote Köpfe geben kann, wenn der Hahn mit seinem Schrei loslegt. Nicht selten enden Konflikte rund um den Güggel sogar vor Gericht.
So geriet 2019 ein Gerichtsurteil in die Schlagzeilen, das einen besonders krähfreudigen Hahn betrifft. Gemeinsam mit zehn Hennen wurde er in einer «von Einfamilienhäusern mit grosszügigem Umschwung geprägten Umgebung» gehalten, in welcher das hobbymässige Hühnerhalten erlaubt ist. Die Baubewilligung für den Hühnerstall wurde allerdings teilweise erst nachträglich erteilt. Drei anwohnende Hausbesitzer fochten die Baubewilligung an. Der Grund: der Güggel. Anhand von Lärmmessungen zeigten sie, dass der Hahn aus 15 Metern Entfernung 84 Dezibel laut krähte – und das teilweise bis zu 44-mal pro Stunde.
Doch die Kläger verloren vor Gericht: Wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtete, darf der Hahn laut Urteil werktags ab 8 Uhr sowie sonntags ab 9 Uhr jeweils bis 22 Uhr im Freien krähen. In der übrigen Zeit muss er, dem Urteil zufolge, in einem abgedunkelten Stall gehalten werden. In einem Punkt urteilte das Gericht zugunsten der Klagenden: Das Hühnerhaus muss «genügend schallisoliert» werden. Der Gang an das Gericht kostete die Klagenden 5200 Franken.
Vor der Anschaffung eines Güggels sei an dieser Stelle somit das Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn empfohlen. Nebst der Einhaltung der Nachtruhe, die in der Regel von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens dauert, kennen einige Schweizer Gemeinden Lokalvorschriften zur Hühnerhaltung. Wer einen Güggel halten möchte, sollte vorher also Erkundigungen einholen.
Schliesslich hat die Haltung eines Hahns durchaus auch Vorteile, die über die Fortpflanzung hinaus gehen: Bei Streitigkeiten unter Hennen übernimmt er die Rolle des Schlichters, kann also für Frieden und einen besseren Zusammenhalt in der Hühnerschar sorgen. Auch schützt er seine Hennen vor Feinden wie Greifvögeln, Füchsen oder Mardern. Für den Schutz seiner Gruppe lässt er, wenn nötig, gar sein Leben.
Ausstieg aus dem Kükentöten
Auch in der gewerblichen Hühnerhaltung hat der Güggel gegenüber seinen Schwestern oft das Nachsehen. Der simple Grund: Ein Güggel kann keine Eier legen. Die meisten männlichen Küken überleben den ersten Tag ihres Lebens daher nicht: Bis Ende 2019 wurden sie lebendig geschreddert. Mit einer entsprechenden Anpassung der Tierschutzverordnung wurde dieser umstrittenen Methode 2020 ein Ende gesetzt. Weiterhin erlaubt blieb jedoch die Tötung männlicher Küken mit Kohlendioxid, um sie dann zu Biogas zu verarbeiten oder als Tierfutter zu verwenden.
Letzten August verkündete die Schweizer Eierbranche schliesslich den Ausstieg aus dem Kükentöten: Durch die In-Ovo-Geschlechtsbestimmung, welche Magnetresonanztomographie mit künstlicher Intelligenz kombiniert, soll das Geschlecht des Embryos am elften oder zwölften Tag der Bebrütung – also noch vor dem Einsetzen des embryonalen Schmerzempfindens – festgestellt werden.
Zwei grosse Brütereien nehmen die dafür notwendigen technischen Einrichtungen seit Jahresbeginn in Betrieb. Bis Ende Dezember sollen die Prozesse vollständig implementiert sein. Der Umstieg auf die Geschlechtserkennung im Ei erfolge in der konventionellen Landwirtschaft somit in einem Schritt, sagte die Eierbranche im August.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Biolandwirtschaft. «Alle Küken sollen leben», lautet die Kernaussage eines Ausstiegsplans, den die Delegierten von Bio Suisse 2021 verabschiedeten. Soll heissen: Nein zu In-Ovo, aber ja zur Aufzucht männlicher Küken. Bis Ende 2025 sollen unter der Knospe keine männlichen Küken mehr ihr Leben lassen.






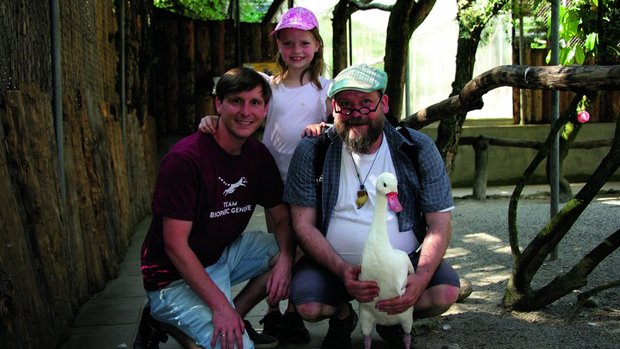








Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren