Das grosse Quaken
22 Fragen über Frösche
Ob klassisch grün oder bunt, laut quakend oder gut versteckt, die Jungen auf dem Rücken tragend oder im Laichballen zurücklassend – Frösche zeigen eine erstaunliche Artenvielfalt. Wie sie sich an zum Teil widrige Lebensumstände anpassen können und was sie bedroht, erklärt Irina Bregenzer vom Karch.
Was ist ein Frosch?
Frösche sind Amphibien aus der Ordnung der Froschlurche. Neben dem, was wir landläufig als Frösche bezeichnen, umfasst diese Gruppe auch Kröten und Unken. Neben den Froschlurchen umfassen die Amphibien auch die Schwanzlurche (Molche und Salamander) und die Blindwühlen (wurmartige Lurche ohne Gliedmassen, die in Europa nicht vorkommen).
Was macht Frösche biologisch besonders im Vergleich zu anderen Tieren?
Frösche haben wie alle Amphibien zwei Lebensphasen: Die Eier und Kaulquappen leben im Wasser, die ausgewachsenen Tiere zu grossen Teilen an Land. Um sich an das Leben an Land anzupassen, durchlaufen die Kaulquappen eine komplette Umwandlung des Körperbaus (Metamorphose) hin zum fertig entwickelten Fröschchen. Das unterscheidet sie von den Molchen und Salamandern, deren Larven schon eine ähnliche Form haben wie die ausgewachsenen Tiere.
Wie viele Froscharten gibt es in der Schweiz und wie viele weltweit?
Die Froschlurche umfassen weltweit rund 7500 Arten. Diese Zahl wächst ständig, da immer noch regelmässig neue Arten entdeckt werden. In der Schweiz gibt es sechs einheimische Froscharten sowie vier Kröten- und Unkenarten.
In welche Regionen der Welt gibt es die grösste Vielfalt an Fröschen?
Die grösste Anzahl an Froscharten findet man in subtropischen und tropischen Regionen.
Was ist die grösste Froschart, und wo lebt sie?
Diesen Rekord hält der Goliathfrosch. Er lebt in Zentralafrika und kann über 30 Zentimeter lang und über drei Kilogramm schwer werden. Goliathfrösche leben oft in der Nähe von Wasserfällen und Flüssen und bauen kleine Wasserbecken als Nester für ihre Eier und Kaulquappen.
Wie schaffen es Frösche, in so unterschiedlichen Klimazonen zu überleben?
Frösche haben viele unterschiedliche Anpassungen an ihre Lebensräume. Arten, die in kühlen Regionen oder im Gebirge vorkommen, sind nur in den wärmeren Monaten aktiv und verbringen den Rest der Zeit in einem frostsicheren Versteck. Der Waldfrosch, der in Alaska und Kanada bis weit in den Norden vorkommt, kann in seinem Körper sogar ein Frostschutzmittel bilden, das ihm erlaubt, komplett einzufrieren, ohne dass seine Organe und Zellen beschädigt werden. In Wüsten lebende Arten sind oft nachtaktiv, um der grössten Hitze zu entkommen. Weil offene Wasserflächen in diesen Gegenden so selten sind, haben einige Arten wie der kugelrunde Wüstenregenfrosch eine Fortpflanzungsstrategie entwickelt, die sie völlig unabhängig von Gewässern macht: Sie legen ihre Eier stattdessen in Erdhöhlen und die Jungtiere schlüpfen als fertig entwickelte Fröschchen.
Was machen Frösche bei uns im Winter?
Frösche sind wechselwarm, ihre Körpertemperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab. Im Winter ist es ihnen bei uns zu kalt, um aktiv zu sein und auf Nahrungssuche zu gehen, sie halten deshalb eine Winterruhe. Sie verkriechen sich in Erdlöchern und anderen frostsicheren Verstecken oder überwintern am Grund von Gewässern.
Wie kommunizieren Frösche miteinander?
Das wichtigste Kommunikationsmittel der Frösche sind ihre Rufe. Sie sind bei jeder Art anders und werden von Experten oft zur Einschätzung der Grösse von Frosch- und Krötenpopulationen genutzt. Die meisten Froschgesänge dienen dazu, Rivalen vom Revier fernzuhalten und Partner anzulocken. Froscharten, die in lärmigen Umgebungen wie zum Beispiel an schnell fliessenden Bächen leben, haben oft auch eine Körpersprache und kommunizieren durch Winken, Kopfnicken etc.
Wie finden Frösche Partner während der Paarungszeit?
Bei den meisten Frosch- und Krötenarten singen die Männchen, um Partnerinnen anzulocken. Die bekannten lauten Quakkonzerte an unseren Teichen und Seen stammen zum Beispiel von Wasserfroschmännchen in Paarungslaune. Besonders attraktiv ist der glockenähnliche Paarungsruf der Geburtshelferkröte, sie wird deshalb auch Glögglifrosch genannt. Daneben haben zum Beispiel der Grasfrosch und die Erdkröte die Strategie der «explosionsartigen» Fortpflanzung entwickelt. Die Tiere erscheinen im Frühling in einem sehr kurzen Zeitraum in riesigen Mengen an ihren Laichgewässern. Durch dieses perfekte Timing erhöht sich die Chance, dass möglichst viele Tiere einen oder mehrere Partner finden können.
[IMG 2]
Wie schützt sich ein Frosch vor Fressfeinden?
Frösche und Kröten haben verschiedene Hilfsmittel, um nicht gefressen zu werden. Drüsen auf ihrer Haut sondern eine Substanz ab, die sie für Fressfeinde giftig oder zumindest ungeniessbar macht. In den Tropen haben viele Arten, wie zum Beispiel die Baumsteiger- und Pfeilgiftfrösche, zusätzlich Warnfarben, die den Räubern schon von Weitem mitteilen, dass sie ungeniessbar sind. Die einheimischen Erdkröten blähen sich auf, wenn sie angegriffen werden. So wirken sie grösser und wehrhafter und sind schwieriger herunterzuschlucken. Wasserfrösche sonnen sich oft am Gewässerrand – werden sie angegriffen, retten sie sich mit einem Sprung ins Wasser. Viele Frosch- und Krötenarten sind zudem nachtaktiv und so durch die Dunkelheit vor vielen Fressfeinden geschützt.
Welche Rolle spielen Frösche in den Ökosystemen, in denen sie leben?
Frösche spielen eine wichtige Rolle als Art, die sich in der Mitte der Nahrungskette befindet. Sie fressen Insekten und andere Kleintiere und helfen damit, ihre Bestände zu regulieren. Sie sind aber auch eine wichtige Beutequelle für viele andere Arten wie Vögel, Schlangen, Iltisse und viele mehr. Die meisten einheimischen Froschlucharten haben eine Fortpflanzungsstrategie, die darauf beruht, möglichst viele Nachkommen zu produzieren. Dabei überlebt oft nur ein Bruchteil der Larven und Jungtiere und der Rest bildet eine wichtige und reichhaltige Nahrungsgrundlage für das ganze Ökosystem.
Frösche sind zudem wichtige Schirmarten für ihre Lebensräume. Sie sind der breiten Bevölkerung sympathisch und ihre Lebensweise fasziniert. Fördermassnahmen stossen deshalb oft auf Wohlwollen. Damit tragen sie auch zum Schutz von vielen anderen Lebewesen wie Insekten, Spinnen, Schnecken oder Pilzen bei, die die gleichen Lebensräume benötigen, aber weniger Sympathie erwecken.
Wie beeinflusst die Verschmutzung von Gewässern Frösche und ihre Entwicklung?
Frösche nehmen über ihre durchlässige Haut Verunreinigungen aus dem Wasser in sich auf. Es gibt viele Laborversuche, die zeigen, dass Pestizide, Chemikalien im Strassenabwasser und andere Verunreinigungen das Wachstum der Kaulquappen beeinträchtigen und in höheren Konzentrationen auch zum Tod führen können. Was aber in der Natur passiert, wo ein ganzer Cocktail dieser Stoffe in unterschiedlichen Konzentrationen zusammenkommt, ist schwieriger einzuschätzen. Eine Reduktion von Pestiziden und anderen Schadstoffen in Gewässern hat aber sicher eine positive Auswirkung für die Frösche.
Warum haben Frösche so unterschiedliche Farben und Muster?
Die Farbe ist von der Lebensweise der verschiedenen Arten abhängig. Viele Arten setzen auf Tarnung, ihr Aussehen ist an ihren jeweiligen Lebensraum angepasst. Andere haben bunte Farben, um ihre Fressfeinde vor ihrem Hautgift zu warnen. Die Gelbbauchunke kombiniert beides: Ihre Oberseite ist graubraun und in schlammigen Tümpeln perfekt getarnt. Fühlt sie sich bedroht, zeigt sie ihre leuchtend gelb-schwarz gemusterte Bauchseite zur Abschreckung des Angreifers.
Können Frösche ihre Farbe wechseln?
Es gibt verschiedene Arten, deren Farbe sich ändern kann. Der in der Schweiz heimische leuchtend hellgrüne Laubfrosch kann zum Beispiel dunkler werden, wenn es kalt ist, und so mehr Wärme vom Sonnenlicht aufnehmen. Bei hohen Temperaturen erscheinen die Tiere heller. Manchmal sieht man auch Laubfrösche, die braun oder grau sind, je nach Umgebung und Untergrund.
Was sind die grössten Bedrohungen für Frösche weltweit?
Sowohl weltweit als auch in der Schweiz ist die grösste Bedrohung für Frösche und andere Amphibien der Verlust von geeigneten Lebensräumen. Das Abholzen von Urwäldern, die Trockenlegung von Feuchtgebieten und die Verschmutzung von Gewässern haben die Lebensgrundlage der Frösche in vielen Gebieten zerstört. In Europa sind auch die Flussauen sehr wichtige Lebensräume für Froschlurche. Eine natürliche Aue verändert sich ständig. Hochwasser lagern das Flussbett um und schaffen neue Tümpel und offene Flächen. Die mäandernden Flussarme verschieben sich, Altarme werden abgeschnitten, neue Flussläufe entstehen… In solchen dynamischen, sich ständig wandelnden Landschaften fühlen sich Amphibien am wohlsten. Da diese Gebiete für den Menschen keinen direkten Nutzen haben, sind sie leider zu einem grossen Teil verschwunden.
Und in der Schweiz?
In der Schweiz wurde die Landschaft zur Steigerung der Produktivität systematisch umgebaut: Die saisonalen Schwankungen von Flüssen und Seen wurden durch Gewässerkorrekturen und Kanalisierung unterbunden und ganze Moorlandschaften wurdentrockengelegt. Durch die unzähligen Entwässerungsgräben sind die früher häufigen saisonalen Wasserstellen auf Feldern, Wegen und in Wäldern grösstenteils verschwunden. Die wenigen verbleibenden Laichgewässer sind voneinander isoliert durch strukturarme Landschaften, Siedlungen und Strassen, was den genetischen Austausch behindert. Inzwischen ist das Bewusstsein für das Problem gestiegen, man versucht stellenweise wieder, einen natürlicheren Wasserhaushalt herzustellen. Damit es für die Frösche wieder aufwärts geht, müsste das aber noch viel mehr und grossräumiger passieren.
Welche Frösche gelten als besonders selten oder vom Aussterben bedroht?
In der Schweiz sind dies vor allem die sogenannten Pionierarten. Sie sind für ihre Fortpflanzung auf Gewässer angewiesen, die entweder neu entstanden sind oder regelmässig saisonal austrocknen. Durch das Austrocknen können Fische, Wasserinsekten und ihre Larven dort nicht überleben. Die schlecht gegen Fressfeinde geschützten Kaulquappen der Pionierarten haben deshalb bessere Chancen, bis zur Metamorphose zu überleben. Sie haben auch wenig Konkurrenz von anderen Amphibienarten, die dauernd wasserführende Laichgewässer benutzen können. Ein typisches Beispiel ist die stark gefährdete Kreuzkröte. Die grossen, flachen und regelmässig austrocknenden Gewässer, die sie für ihre Kaulquappen braucht, kann sie oft nur noch in Kiesgruben finden oder in regelmässig überschwemmten Feldern im Kulturland.
Welche Rolle spielen Pilzinfektionen wie der Chytridpilz in der Dezimierung von Froschpopulationen?
Durch den weltweiten Handel mit Amphibien für die Haltung im Terrarium werden Krankheiten weltweit verschleppt. Neben den bekannten Chytridpilzen gibt es auch Viren und andere Krankheitserreger, die so auf Amphibienpopulationen treffen, die keine natürliche Resistenz gegen sie entwickeln konnten. Man hört deshalb immer wieder von ganzen Froschbeständen, die innert kurzer Zeit durch solche Krankheiten ausgelöscht werden. In der Schweiz sind solche Massensterben bisher zum Glück ausgeblieben. Es wurden aber verschiedene eingeschleppte Krankheiten in der Schweiz nachgewiesen. Diese Entwicklung müssen wir im Auge zu behalten, um zu bemerken, falls es auch bei uns zu grösseren Verlusten kommt.
Wie wirkt sich der Klimawandel auf Frösche aus?
Wärme an sich ist für viele Amphibien positiv – sie können länger aktiv sein und die Kaulquappen entwickeln sich schneller. Es gibt deshalb Arten, die man als «Gewinner des Klimawandels» bezeichnen kann, weil sich die für sie geeigneten Klimazonen eher vergrössern. Problematisch sind hingegen die extremen Wetterlagen, die durch den Klimawandel immer häufiger werden. Insbesondere lange Trockenperioden im Frühling und Sommer bringen die wenigen verbleibenden Laichgewässer zum Austrocknen und behindern so die Fortpflanzung der Frösche. Damit verstärkt der Klimawandel die negativen Effekte des Verlusts von geeigneten Lebensräumen.
Was können wir tun, um Frösche und ihre Lebensräume zu schützen?
Die wichtigsten Massnahmen sind der Schutz der bestehenden Amphibienlaichgebiete und das grosszügige Schaffen von neuen Gewässern und Lebensräumen, um den riesigen Verlusten der Vergangenheit entgegenzuwirken. Dazu gibt es verschiedene nationale und kantonale Programme. Wo Gewässer in sehr grosser Zahl neu angelegt werden, erholen sich auch die Amphibienpopulationen. Ein grosser Helfer ist dabei der Biber: Er staut Bäche ein und schafft dadurch Überschwemmungsflächen, die für Amphibien ideale Bedingungen bieten!
Was kann ich als Privatperson dazu beitragen?
Wer einen Garten oder Land hat, kann dieses so natürlich wie möglich gestalten und auf Pestizide und Kunstdünger verzichten. Wichtig sind viele Verstecke wie Asthaufen, Steinhaufen, Scheiterbeigen, Trockenmauern etc., wo sich Amphibien verstecken und Kleintiere als Nahrung finden können. Das Motto ist «Mut zur Unordnung»!
Gartenweiher sind nicht überall sinnvoll: Wenn sie in der Nähe von Strassen sind, können sie die Amphibien in Gefahr bringen, die über die Strasse zum Weiher wandern. Ansonsten können naturnahe Gartenteiche eine wertvolle Ergänzung für die Amphibien sein. Achtung: Auch kleinere Fische fressen Amphibieneier und -larven. Im amphibienfreundlichen Gartenweiher sollte deshalb auf Fische verzichtet werden.
Wer keinen Garten besitzt, kann trotzdem helfen. Sie können sich zum Beispiel freiwillig an Amphibienrettungsaktionen an Strassen, Pflegeeinsätzen in Naturschutzgebieten oder Monitoring-Projekten beteiligen, einem Naturschutzverein beitreten und sich für Amphibienmassnahmen engagieren oder Naturschutzorganisationen unterstützen, die sich für den Amphibienschutz einsetzen.
Was fasziniert Sie persönlich am meisten an Fröschen?
Frösche und andere Amphibien sind extrem vielfältig. Mich faszinieren ihre verschiedenen Lebensweisen und Anpassungen und dass sie so eine enge Beziehung zu ihrem Lebensraum haben. Sie sind Botschafter einer ursprünglichen, wilden und sich dauernd wandelnden Natur, die uns leider grösstenteils abhandengekommen ist. Und wer jemals einer Gelbbauchunke von Nahem in die herzförmigen Augen geschaut oder dem Glockengesang der Geburtshelferkröte gelauscht hat, kann nicht leugnen, dass sie eine eigene spezielle Schönheit haben.

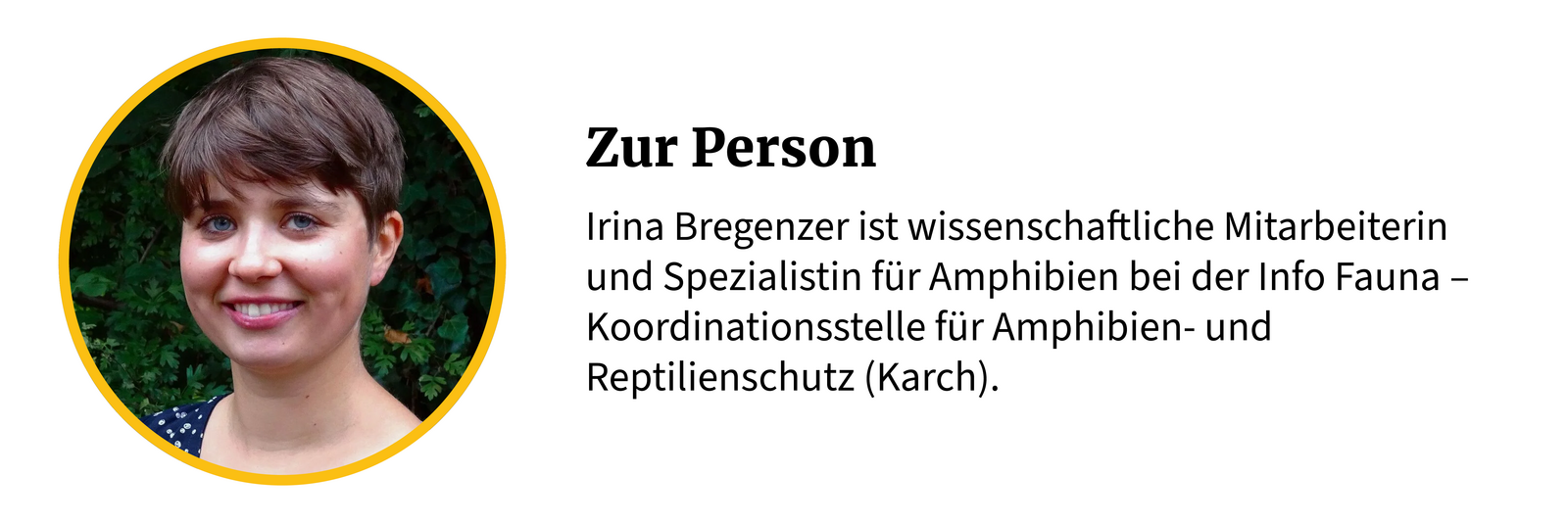















Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren