Vegetation in der Stadt speichert Wasser
Die Stadt als Schwamm
Hitze und heftige Regengüsse machen Städten zu schaffen. Wetterextreme verursachen Probleme und Kosten. Ideal, wenn eine Stadt wie ein Schwamm funktioniert. Bäume machen dies möglich.
Wie können Städte Wetterextremen begegnen? Entweder brennt die Sonne oder es schüttet wolkenbruchartig. Hitze und Überschwemmungen sind die Folge. Strassen und Häuserschluchten heizen sich übermässig auf. Bei Regen sammelt sich das Wasser auf Dächern und Parkplätzen, Strassen werden zu Bächen.
Abhilfe schaffen Pflanzen, besonders Bäume. Damit sie gedeihen können, brauchen sie offene Flächen. Ihr Wurzelwerk reicht weit ins Erdreich. Damit nehmen sie Wasser auf und verdunsten es über die Blätter wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt. Der Effekt vom kühlenden Wald im Sommer wirkt auch in Städten, wenn dort Bäume wachsen. Stefan Stevanovic, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), sagt: «Der Begriff der Schwammstadt wurde in Wuhan in China in den Jahren um 2015 definiert.» Eine Stadt müsse die Funktion eines Schwammes erfüllen, damit Hitze und Überschwemmungen verringert werden könnten. «70 Prozent der Niederschläge…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.















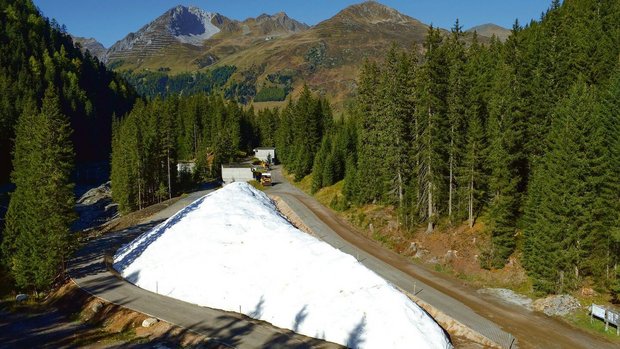




Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren