Ethischer Umgang mit Pferden
Reiten - ein Sport, der bald verboten ist?
Reiter wie Paul Estermann, Andreas Helgstrand oder César Parra haben das Bild des Reitsports beschädigt. Damit kein Verbot erfolgt, Pferde als Sport- oder Freizeitpartner einzusetzen, muss auf einen ethisch korrekten Umgang mit den vierbeinigen Partnern Wert gelegt werden.
Vor über 4000 Jahren hat der Mensch in der Eurasischen Steppe Pferde domestiziert, um sie als Arbeits- und Reittiere einzusetzen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich in dieser Verbindung zwischen Zwei- und Vierbeinern etwas Grundlegendes verändert, zumindest in der westlichen Welt: Das Pferd wurde als Arbeits-, Transport- oder Kriegsmittel obsolet und wandelte sich zum Sport- und Freizeitpartner. Die Bezeichnung «Partner» verdeutlicht es: Immer lauter wird die Forderung nach einer Gleichbehandlung von Mensch und Tier. Das Pferd soll als eigenständiges Subjekt gesehen, mit den gleichen Rechten ausgestattet und nach denselben ethischen Massstäben behandelt werden wie der Mensch. «Für eine zunehmende Anzahl Personen besteht gar kein moralischer Unterschied mehr zwischen Mensch und Tier», sagt Heinrich Binder, der ehemalige Tierschutzbeauftragte des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Gemeinsam mit Michael Hässig, Professor für klinische Epidemiologie am…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.


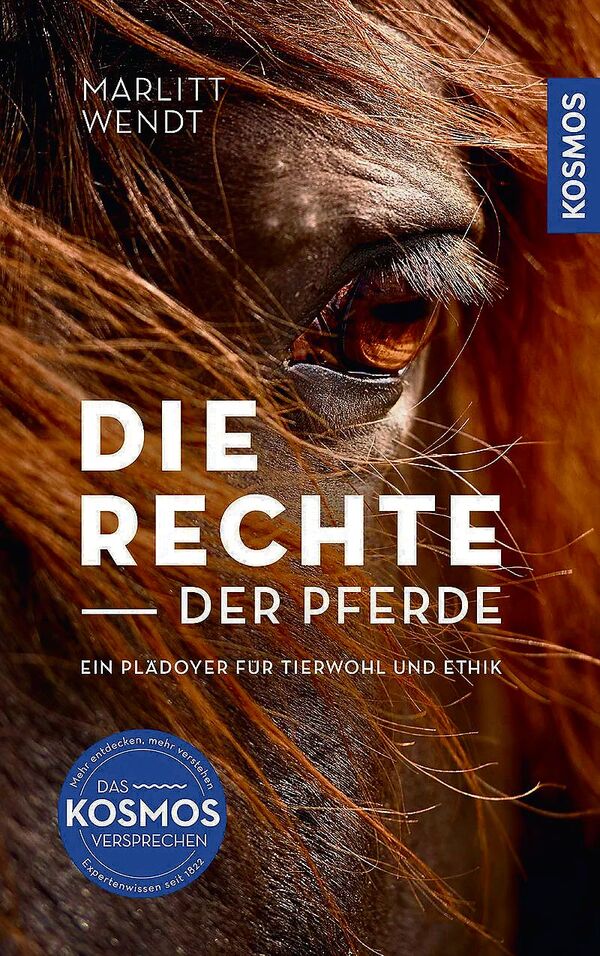













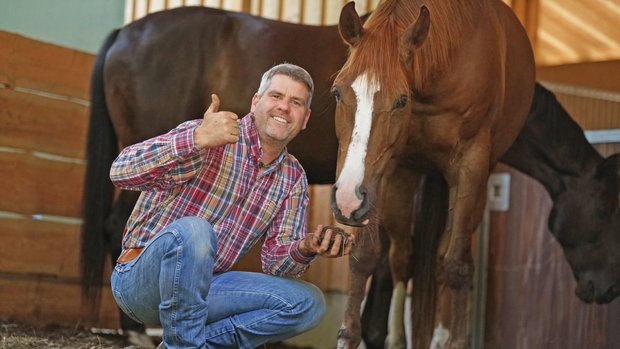

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren