Tierschutz
Per 1. Juli: Importverbot für tierquälerische Pelze tritt in Kraft
Am 1. Juli tritt hierzulande ein Import- und Handelsverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze in Kraft. Die Schweiz ist das erste Land Europas, welches ein solches Verbot im Tierschutzgesetz verankert. Schweizer Tierschutzorganisationen sprechen von einem historischen Schritt, sehen aber Verbesserungspotenzial.
Ab Juli 2025 müssen Schweizer Pelzfach- und Modegeschäfte sowie Onlineanbieter beim Einkauf von Pelzprodukten deren Herstellungsmethode abklären und einen Nachweis über eine nicht-tierquälerische Gewinnungsart erbringen. Ob dieser Nachweis vorliegt, wird der Bund im Rahmen von Kontrollen im Inland und an den Grenzen überprüfen. Widerrechtlich importierte und gehandelte Pelze und Pelzprodukte werden aus dem Verkehr gezogen und fehlbare Personen strafrechtlich verfolgt.
Das Import- und Handelsverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze hat der Bundesrat am 28. Mai 2025 verabschiedet. Es handelt sich um einen Gegenschlag zur Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte», welche der Bundesrat zur Ablehnung empfiehlt. Dies begründet er mit Problemen aus handelsrechtlicher Sicht: Das Importverbot stütze sich nicht auf internationale Normen. Dabei gehe es um die Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) sowie dem Landwirtschafts- und dem Freihandelsabkommen mit der EU.
Der Gegenschlag gehe noch einen Schritt weiter als die Volksinitiative, die lediglich ein Importverbot vorsieht, teilte der Bundesrat Ende Mai mit. Als massgebende Definition von «tierquälerisch» gelten die internationalen Leitprinzipien der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH). Als nicht tierquälerisch gilt unter anderem eine Tierhaltung, die das arttypische Verhalten ermöglicht und bei welcher den Tieren keine Schmerzen, Verletzungen und kein Leid zugefügt werden.
Tierschutzorganisationen: «Wichtiges Signal»
Mit diesem historischen Schritt übernehme die Schweiz eine internationale Vorbildfunktion, schreiben die Tierschutzorganisationen Vier Pfoten, die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) und der Zürcher Tierschutz in einer gemeinsamen Mitteilung. «Dass künftig keine Pelze mehr in die Schweiz eingeführt werden dürfen, die unter besonders grausamen Bedingungen wie Käfighaltung auf Gitterböden oder der Jagd mit Tellereisen entstanden sind, ist ein wichtiges Signal – für mehr Tierschutz und für eine ethischere Konsumkultur.»
Die Institutionen kritisieren jedoch, dass die Regelung nicht weiter gefasst wurde. Der Einsatz grausamer Totschlagfallen gelte beispielsweise nicht als tierquälerisch – somit werde das Fell von Tieren, die auf diese Weise getötet wurden, nicht vom Importverbot erfasst.
Neue Deklarationspflicht für tierische Lebensmittel
Ebenfalls am 1. Juli tritt eine neue Deklarationspflicht für folgende tierische Lebensmittel in Kraft. Folgende Produkte müssen neu gekennzeichnet werden:
- Rindfleisch von Tieren, die betäubungslos kastriert oder enthornt wurden
- Schweinefleisch, wenn die Kastration, das Kupieren des Schwanzes oder das Abklemmen der Zähne ohne Betäubung erfolgte
- Eier und Fleisch von Hühnern, deren Schnabel ohne Schmerzausschaltung kupiert wurde
- Milch von Kühen, bei denen die Enthornung ohne Schmerzausschaltung erfolgte
- Betäubungslos gewonnene Froschschenkel
- Leber und Fleisch von Gänsen und Enten aus der Stopfmast
Die Deklarationspflicht gilt für alle Betriebe, die die betroffenen Lebensmittel anbieten, etwa die Gastronomie oder der Klein- und Detailhandel. So sollen Konsumierende beim Kauf erkennen können, ob die Lebensmittel unter Einsatz schmerzhafter Eingriffe hergestellt wurden, ohne dass die Tiere vorgängig betäubt wurden.
Die drei Tierschutzorganisationen sehen in der Kennzeichnungspflicht zwar einen «Schritt in die richtige Richtung», fordern jedoch weiterhin ein konsequentes Importverbot für die Produkte – insbesondere für Stopfleber.
«Das sogenannte ‹Stopfen› – die Zwangsfütterung von Enten und Gänsen – ist in der Schweiz zu Recht seit über 40 Jahren verboten. Die Tolerierung des Imports solcher Produkte bleibt ein tierschutzpolitischer Widerspruch», schreiben die Institutionen. Eine entsprechende Volksinitiative, die ein Importverbot fordert, befinde sich aktuell im parlamentarischen Prozess.




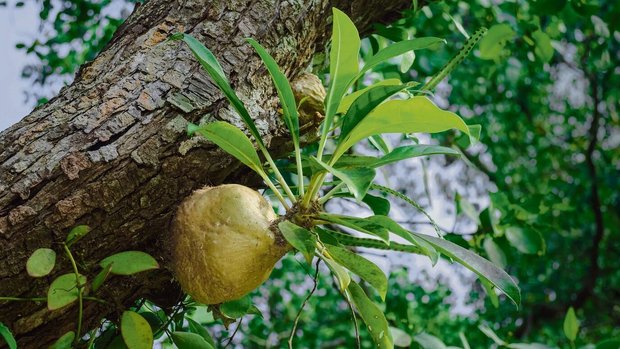










Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren