Haussperling
Vom gejagten Spatz zum geschätzten Helfer
«Lieber den Spatz in der Hand…» Spatzen gehören zu den Sperlingen, von denen es weltweit 36 Arten gibt. Hierzulande leben drei davon, aber nur der Haussperling, im Volksmund auch Spatz genannt, weiss sich in Szene zu setzen.
Sie fliegen Rolltreppen runter, um in Bahnstationen Krümel aus Büürlitüten zu naschen, oder bedienen Lichtschranken, um Türen zu öffnen, hinter denen sie etwas Schmackhaftes vermuten. Auch im Zürcher Hauptbahnhof gehören sie längst zu den Stammgästen und picken die toten Insekten von den Windschutzscheiben und den Puffern der Loks. Warum selbst jagen, wenn ein Buffet angerichtet ist? Spatzen sind eben nicht nur clever, sondern auch mutig. Eine Kombination, die mitunter riskant sein kann. Doch spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts wissen wir: Der Mensch braucht den Spatz genauso wie der Spatz den Menschen.
Damals, genauer gesagt 1957, begann am anderen Ende der Welt, in China, eine Hetzjagd gegen die Vögel. Herrscher Mao erklärte den sogenannten vier Plagen den Krieg, wovon eine der als Körnerdieb geächtete Spatz war. Der Machthaber war überzeugt, dass dieser kleine Vogel die Ernte von den Feldern und das Saat-gut aus den Scheunen frass, und rief ganz China zur Spatzenjagd auf. Drei Tage lang trommelten und pfiffen die Chinesen so laut, dass die Tiere sich nicht trauten zu landen und sich auszuruhen.
Sie zerstörten Nester und schossen die vermeintlichen Schädlinge mit Gewehren und Steinschleudern ab. Das Resultat? Millionen Vögel starben. Allein in Peking sollen es mehr als 400 000 gewesen sein. Was der Diktator dabei nicht im Blick hatte, war das ökologische Gleichgewicht. Denn der Nestlinge Hauptnahrung sind nicht etwa Körner, sondern Heuschrecken und andere Insekten, und die konnten sich nun nicht nur ungehindert vermehren, sondern verleibten sich auch die kostbare Ernte ein.
[IMG 2]
Fehlende Nistplätze
China lernte aus seinem Fehler und siedelte schliesslich Spatzen aus der Sowjetunion an. Doch selbst in Nordeuropa bekam man bis in die 1970er-Jahre hinein mancherorts noch eine Belohnung für jeden toten Spatz. In England befindet sich der Haussperling bereits auf der roten Liste der gefährdeten Vogelarten, und auch in der Schweiz sind die Bestände gebietsweise seit 1980 um 20 bis 40 Prozent zurückgegangen. Dabei sind die drei hierzulande lebenden Arten längst geschützt. Weltweit fliegen laut einer Studie der Royal Society for the Protection of Birds, der grössten Organisation Europas zum Schutz von Wildvögeln, sowie der Vogelschutzorganisation Birdlife International heute 247 Millionen Spatzen weniger am Himmel als noch vor 40 Jahren.
Stefan Bachmann von Birdlife Schweiz spricht von einem «starken Rückgang in vielen Städten», häufig zurückzuführen auf eine Verschlechterung der Habitate und Nahrungsangebote: «Die moderne Bauweise bietet für den Spatz leider kaum noch geeignete Nistplätze. Bei Renovationen von alten Häusern werden Nischen oft verschlossen. Der Haussperling gerät damit in Wohnungsnot.» Dazu kommt, dass viele Gärten immer weniger grün sind, mit Pestiziden behandelt werden oder mit exotischen Pflanzen aufwarten und somit kaum Nahrung in Form von Sämereien und Insekten bereithalten. Spatzen fressen zwar gerne Menschennahrung, für die Aufzucht ihrer Jungen brauchen sie aber genügend Proteine. Und die fehlen so. Auch ihre Sand- und Wasserbäder bleiben laut Birdlife auf der Strecke, da ursprünglich offene Stellen mittlerweile zubetoniert sind.
[IMG 3]
Spatz oder Sperling?Die Namen Sperling oder Spatz stammen ab vom althochdeutschen «spar» oder «sparo» (zappeln), was wohl die hüpfende Fortbewegungsart des Vogels charakterisieren soll. Während der Begriff Sperling schon im 11. Jahrhundert auftauchte, bezeichnete Spatz vorerst den Jungvogel und wird erst seit dem 13. Jahrhundert als Artbezeichnung verwendet.
Link zum Kurzfilm aus Cham:
vimeo.com/609632238
Wer hätte gedacht, dass eine Beziehung, die bereits seit über 10 000 Jahren Bestand hat, tatsächlich in Gefahr gerät? Damals, als der Mensch sesshaft wurde und begann, Getreide anzubauen, erkannte der gerade einmal 16 Zentimeter grosse und 30 Gramm leichte Spatz die Vorteile der Menschenwelt. Er wich den Bauern nicht mehr von der Seite und galt daher rasch als der Körnerdieb schlechthin. Dass Sperlinge keine Einzelkämpfer sind, sondern in Schwärmen auftreten, trug ebenfalls nicht zu ihrer Beliebtheit bei.
Mitte des 19. Jahrhunderts kam es einer regelrechten Auswanderungswelle: «Ursprünglich war der Sperling im Mittelmeerraum zu Hause, dann verschleppten ihn europäische Auswanderer rund um den Erdball», so Heini Hofmann aus Jona. Warum? Laut dem deutschen Zootierarzt und Wissenschaftspublizisten teils aus sentimentalen Gründen, indem sie in ihm eine Handvoll lebendige Heimat sahen, teils aber auch im damaligen Irrglauben, mit ihm einen tüchtigen Helfer für die Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft mitzuführen.
So gelangten die Vögel über die Felder erst in die Dörfer und später bis in die Metropolen und bevölkern nun fast die ganze Erde. Ihre Ausbreitung kam übrigens in Fahrt, als sie die Verkehrsmittel für sich entdeckten und sich entlang von Getreidetransportwegen wie Eisenbahnlinien, Strassen und Wasserkanälen ansiedelten. «Die kleinen frechen Federbälle liessen sich von gemütlichen Getreideschleppkähnen und langsam fahrenden Güterwagen oft über weite Distanzen dahintragen», sagt Hofmann weiter.
[IMG 4]
Vorbildliches Bauen
Ein Blick in unsere Sprache lässt vermuten, dass wir den Vogel inzwischen nicht nur akzeptiert, sondern liebgewonnen haben. Nennt etwa eine Mutter ihr Kind doch oft Spatz oder Spätzli. Andererseits reden wir von Dreckspatzen oder von Spatzenhirnis. Und wenn ein Geheimnis ausgeplaudert wird, heisst es, die Spatzen würden es längst von den Dächern pfeifen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Spatz bleibt zwiegespalten.
Vielerorts stehen die Menschen dem Spatz und auch anderen Vögeln aber eher wohlgesinnt gegenüber.Gemeinden erarbeiten Biodiversitäts-Aktionspläne dafür, Grünflächen und Gewässer zu erhalten und Insekten und andere Wildtiere zu schützen. Dennoch fehlt es oft an der Umsetzung, und noch immer werden etwa Vogelnester an Gebäuden entfernt oder geschlossen. Um die bestehenden Brutplätze zu schützen und eine Übersicht über die Brutstandorte zu erhalten, müssen die Gemeinden sogenannte Gebäudebrüterinventare erstellen lassen. Cham (ZG) etwa hat dies im Jahr 2012 gemacht und lanciert mit diesem Wissen gezielt Schutz- und Fördermassnahmen, die zwar den Mauersegler im Fokus haben, aber ebenso dem Sperling helfen.
Damit auch die Bürger am gleichen Strang ziehen, hat Cham den Kurzfilm «Bauen für und mit dem Mauersegler» produziert, der anschaulich nicht nur auf die Probleme, sondern vor allem auch auf die Lösungsansätze eingeht. Dies sei ein wichtiges Puzzleteil zum Schutz der Vögel, da gute Schutzmassnahmen laut Manuela Hotz, Bereichsleiterin Umwelt, sehr individuell sind und ans Gebäude angepasst werden müssen. Eine weitere Massnahme ist die kostenlose Beratung seitens einer Biologin, die Cham jedem Bauherren anbietet. Dank dieser konnten laut Hotz bereits einige Kolonien erhalten werden. Insgesamt nisten an über 90 Gebäuden in Cham Mauersegler. Tendenz steigend.
[IMG 5]
Dabei brauchen die Vögel nicht viel zum Glücklichsein. Ein Spatzennest würde so manch einer gar als schlampig bezeichnen. Es sind lediglich Grashalme, Plastik- oder Papierstreifen, die in Mauerritzen oder unter Dächern zu einem lockeren Nest zusammengefügt werden. Wer den Vögeln diesen wenigen Luxus gewährt, wird mit einem Schauspiel der besonderen Art belohnt. Vor allem im Frühling ist ganz schön was los. Ab Mitte April beginnt die Paarungszeit, und die Männchen beginnen zu tanzen und zu singen, um sich bei der Auserwählten beliebt zu machen.
Mit aufgestelltem Schwanz, aufgeplustertem Gefieder, hängenden Flügeln und lautem Gezeter tänzeln meist gleich mehrere Männchen um ein Weibchen herum. Wird es dem Weibchen zu viel, fliegt es mit der ganzen Männchenschar im Schlepptau davon. Entscheidet es sich schliesslich für einen der Tänzer, bleibt das Paar meist das ganze Leben lang zusammen. Bis zu vier Bruten schafft es übrigens in einem Jahr. Heraus kommen dabei zwischen 16 und 24 Jungspunde pro Paar, die die Lüfte unsicher machen. In der Regel bleiben Sperlinge auch ihrem Standort treu, sodass die menschlichen Nachbarn sich immer wieder an ihrem Tschilpen erfreuen können. Zugegeben, es tönt eher eintönig statt schön. Laut ist es aber allemal.

















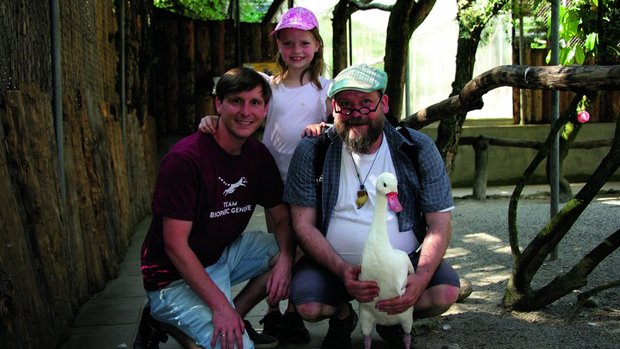

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren