Recycling
Der Wert des Elektroschrotts
127 000 Tonnen Elektroschrott werden in der Schweiz jedes Jahr recycelt. Ausrangierte Kaffeemaschinen und Computer landen unter anderem in der Altola AG in Olten, wo die Geräte mit viel Handarbeit und Sorgfalt auseinandergenommen werden.
Ein Knall, ein Rumpeln, ein Quietschen, ein Hammerschlag. Der Geräuschpegel in der grossen Halle ist hoch. Maschinen surren vor sich hin, ein Gabelstapler kurvt an den meterhohen Palettenwänden vorbei und einige Arbeiter zerlegen Geräte und werfen die Einzelteile in Metallkisten. An diesem Mittwochmorgen herrscht reges Treiben hinter Tor C der Altola AG in Olten. Spezialisiert hat sich die Entsorgungsfirma eigentlich auf Sonderabfälle; insbesondere werden Öl, Lösungsmittel, Laugen oder Säuren verarbeitet und verwertet. In dieser Halle jedoch dreht sich alles um Elektroschrott.
Hinter den Kulissen der Altola AGEgal, ob Kühlschrank, Lautsprecher, Smartphone oder Bügeleisen – in all diesen weggeworfenen Elektronikgeräten stecken wertvolle Materialien, die recycelt werden können. Um an diese Stoffe heranzukommen, benötigt es aber einiges an Sortier- und Demontierarbeit. Über sieben Tonnen Schrott werden hier in Olten jeden Tag verarbeitet und auseinandergenommen. «Hauptsächlich handelt…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.










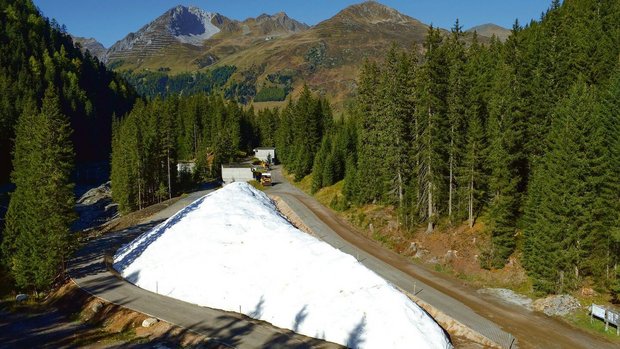



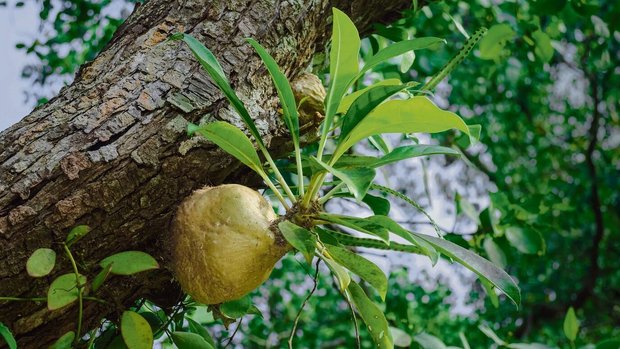




Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren