Nester und Bauten
Diese Tiere sind wahrhafte Baumeister
Ein sicheres und bequemes Zuhause zu haben, ist nicht nur das Ziel der meisten Menschen. Auch Tiere nehmen viel Zeit und Aufwand in Kauf, um sich das perfekte Heim zu schaffen. Dabei entstehen nicht selten architektonische Meisterwerke.
Ein Architekturstudium dauert gut fünf Jahre an der Fachhochschule, und Bauingenieure haben in der Regel auch drei Jahre die Hochschulbank gedrückt, um alles über Baumaterialien, Konstruktionstechniken und Statik zu lernen. So viel Zeit haben aber die meisten Tiere nicht, und trotzdem erschaffen einige Arten wie aus dem Nichts erstaunlich tolle Bauwerke.
Dämme aus HolzDer Biber (Castor fiber und Castor canadensis) ist dabei einer der bekanntesten Experten. In seinem Revier legt er bis zu zehn Wohnbauten unterschiedlichster Form an. Der Wohnkessel darin ist nur durch einen Eingang unter Wasser erreichbar, wohin ihm seine Fressfeinde nicht folgen können. Um das zu erreichen, baut der Biber Dämme, um die Umgebung rund um den Bau so zu fluten, dass der Eingang immer etwa 60 Zentimeter unter der Wasseroberfläche liegt. Dafür staut er einen Bach oder einen kompletten Fluss durch herbeigeschlepptes Baumaterial.
Mit seinen kräftigen Zähnen schafft er es sogar, Bäume mit einem…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.
























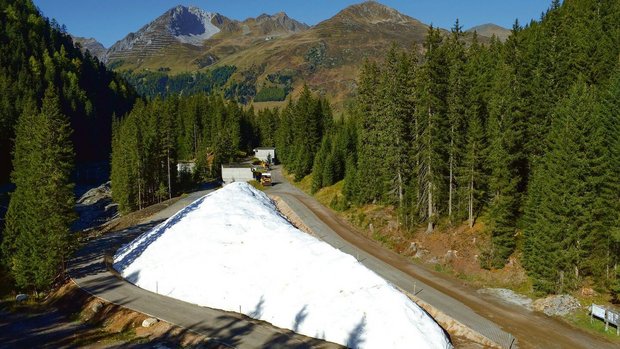


Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren