Angepasster Sommervogel
Faszinierende Schmetterlinge der Alpen: Hochalpenwidderchen
Bis hoch in die Gletscherzone unserer Alpen finden sich bestens angepasste Schmetterlinge, die ihren ganzen Lebenszyklus unter harschen Bedingungen verbringen. Einer davon ist das auffallende, hübsche Hochalpenwidderchen.
Dem Hochalpinisten begegnen ab und zu und vor allem im Frühling vorzugsweise an Passübergängen Schmetterlinge. Mit günstigen Winden und Thermik gelingt dieses Kunststück vor allem den Edelfaltern Admiral, Kleiner Fuchs und Distelfalter. Diese Falter meistern zwar in grösserer Anzahl den Flug über die Alpen, länger verweilen können sie da aber nicht. Ihr Lebensraum ist in weit tieferen Regionen.
Doch einige wenige spezialisierte Arten wie der unscheinbare Gletscherspanner (Psodos wehrlii) und Vertreter ebenso diskret gefärbter Angehöriger der Mohrenfalter (v.a. Erebiamontana und Erebia nivalis) teilen sich den Lebensraum Hochgebirge und schaffen den Kraftakt des Überlebens vom Ei bis zum Schmetterling unter härtesten Bedingungen. Der auffälligste und auch farbigste davon ist das Hochalpenwidderchen (Zygaena exulans).
Ausserhalb der Alpen ist diese Art noch in den Pyrenäen, den Abruzzen, auf der Balkanhalbinsel, in Schottland, Skandinavien sowie im Altaigebirge nachgewiesen. Die…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.







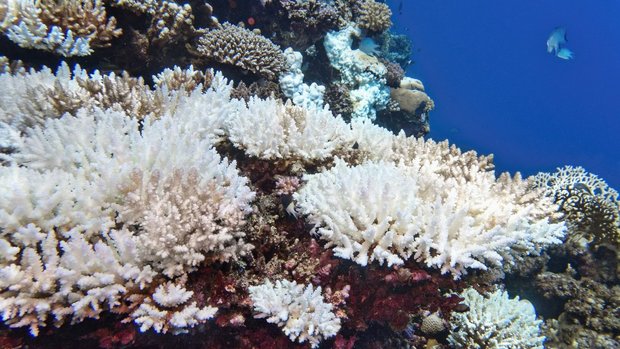








Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren