Pseudoskorpione
Skorpione ohne Stachel
Die winzigen Spinnentiere erinnern mit ihren Scheren an Skorpione, sind aber für den Menschen völlig harmlos. Pseudoskorpione verspeisen andere Insekten und werden daher zum Teil sogar als Nützlinge eingesetzt.
Bereits vor 380 Millionen Jahren wuselten sie auf ihren acht Beinen über das feuchte Erdreich. Die beiden vordersten Arme enden in beeindruckenden Scheren, die bei den meisten Arten mit einer Giftdrüse versehen sind. Gemeint sind nicht die Skorpione, auch wenn sie ihnen in gewisser Weise ähneln, sondern ihre Namensvetter, die Pseudoskorpione.
Kleine, aber bedeutende SpinnentiereWie die Skorpione zählen auch sie zu den Spinnentieren, sind aber wesentlich weniger bekannt. Das mag in erster Linie an ihrer winzigen Grösse liegen, die meistens im Bereich einiger Millimeter liegt. Sie sind daher von blossem Auge oft kaum wahrnehmbar.
Pseudoskorpione in der SchweizAuch wenn sie sich meist jenseits unserer Wahrnehmung bewegen, so leben in der Schweiz doch 63 Arten der Pseudoskorpione. Man findet sie vor allem in der Laubschicht, unter Moos oder Pilzmatten sowie unter loser Baumrinde. Sie fressen wie alle Spinnentiere andere Gliedertiere wie die noch winzigeren Springschwänze. Mit den…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.









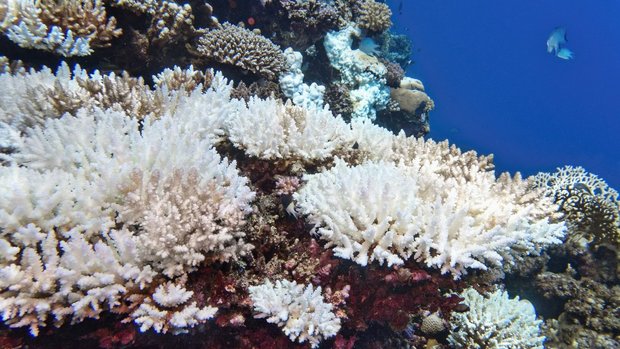






Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren