Der wahre König der Lüfte
Bartgeier in den Alpen: Ein majestätischer Jäger kehrt in die Schweiz zurück
Der Bartgeier ist mit einer Flügelspannweite von fast drei Metern der grösste Brutvogel der Alpen. Früher missverstanden und gejagt, feiert er heute ein Comeback. Hinter dem Erfolg steht ein ausgeklügeltes Auswilderungs- und Monitoringprogramm.
In der klirrenden Kälte des frühen Dezembermorgens wagen sich nur wenige Menschen in einen der hinteren Winkel des Saastals (VS). Unter ihnen ist die Biologin Julia Wildi und ihr Begleiter, der Gymnasiast Léo Jeanneret. Dick eingepackt in Outdoorjacken, mit Spektiv und Kamera auf den Schultern, lassen sie ihren Blick über die steilen Felswände der Walliser Alpen schweifen.
Für den einsamen Steinbock, der vom Gipfel des Mittaghorns zu ihnen hinunterblickt, haben die beiden kaum Augen, denn ihr Interesse gilt einem ganz anderen König der Berge. Dieser hat seinen royalen Auftritt nur wenig später. Eine dunkle Silhouette schwebt hinter der Felskante hervor und zeichnet sich deutlich gegen den blauen Himmel ab. Mit seinen fast drei Metern Spannweite ist kein anderer Vogel der Schweiz so gross wie der Bartgeier (Gypaetus barbatus).
Ausgewachsene Tiere haben eine Körperlänge von 90 bis 125 Zentimetern und wiegen bis zu sieben Kilogramm. Mit langsamen Flügelschlägen fliegt das Männchen zu…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 9 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.
















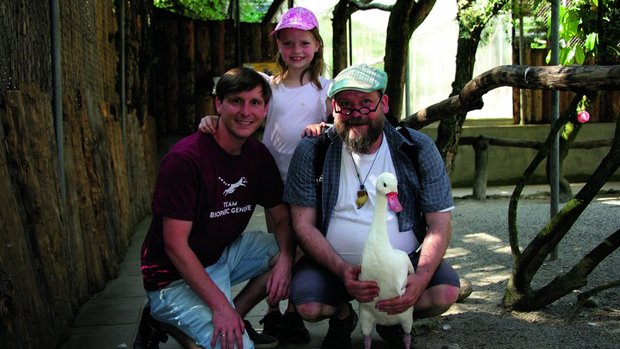

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren