Bauen mit Lehm
Die «Schlössli-Schüür»: Ein Leuchtturmprojekt aus Kork und Lehm
Heute müssen Gebäude vor allem schnell und günstig entstehen. Zement und Beton sind nicht mehr aus der Baubranche wegzudenken. Dass das auch nachhaltiger geht, davon ist Roman Droux überzeugt. Mit der Unterstützung von Freunden und Interessierten baut er in Kirchdorf eine alte Holzscheune in ökologischen Lebensraum um.
Die Schlössli-Schüür in Kirchdorf ist die grösste historische Scheune im Kanton Bern und steht schon seit 300 Jahren im Südosten der Gemeinde. In den vergangenen Jahrhunderten diente sie als Heu- und Kornspeicher, als Früchte- und Gemüsekeller oder beherbergte Schweine, Kühe und andere Nutztiere. Seit einigen Jahren stand sie jedoch ungenutzt da, bis Annlis von Steiger, Roman Droux und einige helfende Hände anfingen, die denkmalgeschützte Holzscheune von den Altlasten zu befreien und für eine neue Zukunft vorzubereiten: Aus den Abfallprodukten Flaschenkork und Baugrubenlehm soll hier in den kommenden Jahren ein Wohnraum gelebter Nachhaltigkeit entstehen.
Im Gebäude nebenan liegen die Rohstoffe für das Projekt bereit. Mehrere Dutzend Big Bags sind mit geschredderten Korkzapfen und Lehmpulver gefüllt, auf Holzregalen und Paletten stapeln sich trockene und feuchte Bausteine aus Lehm und Kork. Hier macht sich Droux mit seinem Team ans Werk und presst die Bausteine für das Projekt einzeln von Hand. 15 000 Stück braucht er insgesamt und schon seit mehr als einem Jahr ist er am Produzieren. «Wir müssen das Bauen grundsätzlich neu denken», sagt er und meint damit keine halben Sachen. Im Innern der Scheune soll eine Holzständerkonstruktion ein Haus in einem Haus bilden, die mit den Lehm-Kork-Steinen ausgefacht wird: Über zehn unterschiedlich grosse Wohneinheiten mit je 20 Quadratmetern pro Person und vielen Gemeinschaftsräumen sind vorgesehen, gebaut mit natürlichen Rohstoffen. Das Millionen-Projekt wird ausschliesslich über den Verkauf dieser Wohneinheiten an zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner finanziert, wie Droux weiter erklärt.
Die Sanitäranlagen will er ebenfalls neu denken, und zwar zirkulär. Das heisst, zum Duschen und Waschen wird Regenwasser aufbereitet, der Urin separiert und die Fäkalien zu Kompost verarbeitet, damit kein Trinkwasser dafür verschwendet wird. «Das kann es doch nicht sein», sagt er. «Wir wollen bewusster mit unseren Ressourcen umgehen.»
[IMG 2-4]
Handgemachtes Zuhause
Unterstützt wird der Filmemacher Roman Droux dabei von Manuel Bühler, einem autodidakten Lehmbauer mit eigenem Unternehmen in Münsingen. Denn ganz so einfach ist regeneratives Bauen heutzutage nicht: Der Ausbau der alten Scheune muss in Sachen Brandschutz und Isolation den Neubaustandards entsprechen. «Bauen mit Lehm ist nach wie vor eine Nische. Es gibt daher wenige bis keine Präzedenzfälle oder Gesetze dazu», sagt Bühler. So experimentierten Droux und sein Team lange mit der Zusammensetzung der Lehmsteine, um die vorgegebenen Isolationswerte einzuhalten, auch mit Hanf- oder Strohfasern. Schliesslich isolierte Kork am besten und wird nun als Granulat in die Lehmsteine verarbeitet. Dabei konnte das Team vom Vorwissen und der Erfahrung von Hansruedi Egli profitieren, der diese Kork-Lehm-Steine entwickelt hat.
Schliesslich ist Lehm eines der ältesten Baustoffe der Welt. Im Nahen und Mittleren Osten etwa konnten über 10 000 Jahre alte Lehmbauten nachgewiesen werden. Aber auch in Europa kann man Lehm als Baustoff bis zu 5000 Jahre v. Chr. zurückverfolgen. Seit dem Mittelalter wird er hier besonders im Fachwerkbau verwendet und ist nichts anderes als Erde, die sich unterhalb der Humusschicht befindet. Er besteht aus unterschiedlich feinem Gestein: Ton, Schluff und Sand. Manchmal ist auch Kies enthalten und die Zusammensetzung ist je nach Lehm unterschiedlich. Getrocknet und ungebrannt kann Lehm mit Wasser gemischt immer wieder ohne weiteren Energieaufwand verwendet werden und gilt daher als besonders nachhaltig. Er trägt auch massgeblich zu einem angenehmen Raumklima bei, da er Feuchtigkeit und Wärme speichert und nur langsam wieder abgibt, erklärt Manuel Bühler.
Mit der Industrialisierung jedoch wich Lehm allmählich Ziegelsteinen und Beton, wird heute aber wieder neu entdeckt und für diverse Zwecke verwendet. Er wird im Massivbau, zu Lehmsteinen gepresst als selbsttragende Innenwände verwendet oder zu Stampflehm verarbeitet als lasttragende Wände. Aber auch als Putz im Ofen- und im Leichtbau kommt er zum Einsatz. Zu den neusten Lehmbauten in der Schweiz gehören beispielsweise das Besucherzentrum der Vogelwarte in Sempach oder das Kräuterzentrum von Ricola in Laufen.
[IMG 5-9]
Zwischen Effizienz und Nachhaltigkeit
Aber auch im kleinen Rahmen entstehen immer wieder neue Lehmbau-Projekte, beispielsweise wenn Familien ein eigenes Lehmhaus bauen wollen. Auch diesen steht Lehmbauer Bühler beratend zur Seite. Die Kosten eines Lehmhauses weichen laut dem Experten nicht gross von jenen eines herkömmlichen Neubaus ab: Fünf Prozent mehr schätzt er. «Aber diejenigen, die mit Lehm bauen wollen, legen gerne selbst Hand an.» Das reduziere die Kosten erheblich. Wer die Lehmsteine beispielsweise selbst presst, der spart sich wie Droux die Arbeitskosten für diesen Schritt und muss «nur noch» die Arbeit der Baumeister wie Bühler zahlen. Er mauert die Lehmsteine mit Mörtel aufeinander und verputzt die Wände. Und das Interesse an dieser Art des Bauens wächst, wie er sagt. Auch im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 mit dem Ziel Netto Null, wo Zement mit einer schlechten Umweltbilanz ins Auge sticht.
Das Problem bei Zement liegt in seiner Herstellung: Er besteht aus Kalkstein und Mergel, die fein gemahlen auf über 1400°C erhitzt werden müssen. Dieser Prozess setzt viele Treibhausgase frei, die zu einem Drittel beim Anheizen entstehen und zu zwei Dritteln aus Stoffen bestehen, die aus dem Kalkstein entweichen. Wird das Gemisch schliesslich mit Sand, Kies und Wasser ergänzt, entsteht fester Beton. Die Tatsache, dass Zement einer der meistgenutzten Rohstoffe weltweit ist, verschärft die Umweltbelastung des Rohstoffs.
«Es braucht zwangsläufig Alternativen und Lehm ist das Nummer-eins-Produkt», so Bühler. Er frage sich allerdings, wie grossflächig es in Zukunft eingesetzt werden kann. Projekte wie die Scheune in Kirchdorf aber könnten wegweisend sein. «Es ist ein Leuchtturmprojekt», sagt der Lehmbauer. Ende 2023 konnte auch das Baugesuch dafür eingereicht werden.
Forschung an Lehm
Für die Industrie ist Lehm bisweilen uninteressant, da der Baustoff noch nicht als tragendes Element verwendet werden kann. Aufgrund der hohen Umweltbelastung von Beton jedoch steigt das Interesse der Forschung am Thema. Das Forschungsinstitut der ETH für Materialwissenschaften Empa etwa untersucht seit 2022 Möglichkeiten, mit welcher Mineralmischung Lehm dieselben Eigenschaften wie Beton erhält und allenfalls Einsatz in der Industrie findet. «Die Hauptmotivation dabei ist die Reduktion von Treibhausgasen», sagt Raphael Kuhn, Doktorand am Forschungsinstitut. Erste Erfolge gibt es bereits mit «Oxara», einem Erdbeton auf Lehmbasis, der sich im frischen Zustand giessen lässt und rasch aushärtet. Er eignet sich für den Einsatz in Böden und nicht tragenden Wänden. Trotzdem sieht Kuhn noch keine Möglichkeit, in absehbarer Zeit komplett von Beton wegzukommen: «Ein kompletter Ersatz von Beton in der Industrie wird wahrscheinlich nicht möglich sein.»

















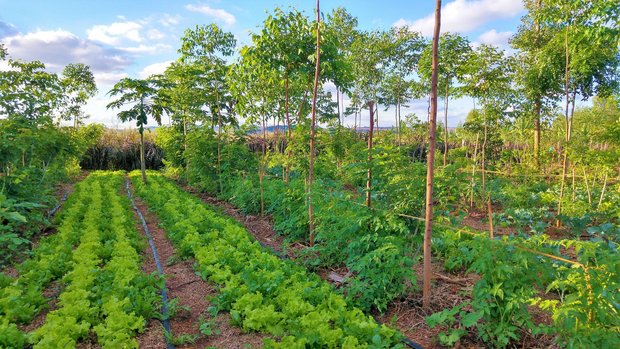






Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren