Interview
Peter Wohlleben erklärt den Unterschied zwischen Mensch und Tier
Peter Wohlleben ist der wahrscheinlich bekannteste Förster Deutschlands. Ein echter Baumflüsterer. Seine Bücher sind Bestseller. Ein Gespräch über die Selbstbestimmung des Menschen und das Tierische im Homo sapiens.
Herr Wohlleben, was unterscheidet den Menschen vom Tier?
Im Alltag interessanterweise fast nichts. In den Fähigkeiten jedoch vieles, denn Vögel schreiben keine Bücher und Hunde fliegen nicht zum Mond. Im alltäglichen Verhalten und im Umgang miteinander hinsichtlich Bevölkerungsentwicklung und Revierverhalten gibt es jedoch keine signifikanten Unterschiede.
Wie tierisch ist der Mensch?
Der Mensch ist total tierisch. Ein einfaches Beispiel: Eine hohe Population bei Tieren wie Kaninchen, Luchsen, Rehe oder Vögeln erzeugt Stress und es sinkt die Geburtenrate. Bei uns Menschen ist zu beobachten, dass die Spermaqualität der Männer laufend und mit zunehmender Geschwindigkeit nachlässt. Wissenschaftler wissen nicht, woran das liegt. Doch die menschliche Komfortzone beziehungsweise Distanzzone liegt bei ein bis vier Metern. In Städten wird diese ständig unterschritten und das macht Stress. Von der Populations-dynamik sitzen wir also mit Tieren in einem Boot.
Ist der Homo sapiens dem Tier…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.
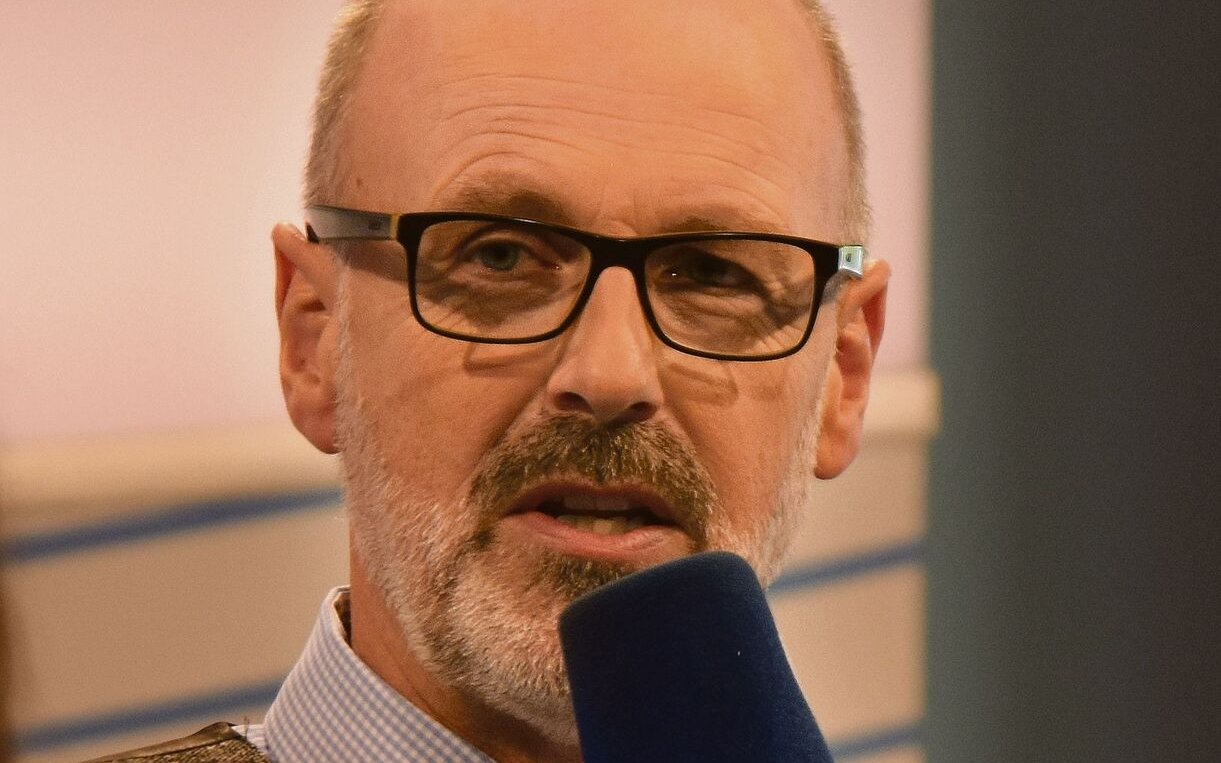





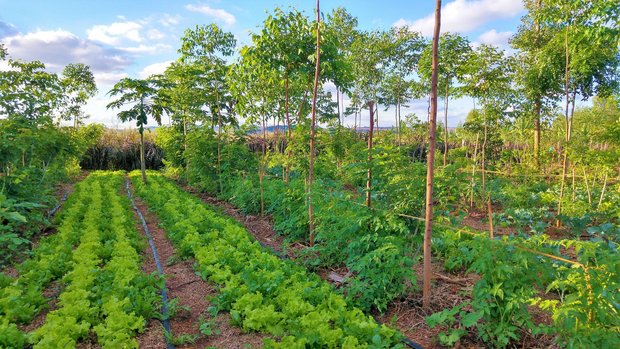









Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren