Flora und Fauna
Profiteure des Klimawandels
Die immer wärmeren Temperaturen bringen viele unserer heimischen Tierarten zunehmend ins Schwitzen. Doch was für die heutige Biodiversität eine Bedrohung darstellt, kann für einzelne Arten auch eine Chance sein.
Die Schweizer Baumgrenze wird sich bis Ende des Jahrhunderts um 500 bis 700 Meter nach oben verschieben. Dieses Szenario hat das Forschungsprogramm Wald und Klimawandel für den Fall errechnet, in dem es gelingt, die globale Temperaturerhöhung auf 2 Grad oder weniger zu begrenzen. Für die Schweiz würde das bereits eine durchschnittliche Erwärmung von 3 bis 4 Grad bedeuten. Dass eine solche Veränderung unsere Natur stark beeinflusst, liegt auf der Hand. Manche Baumarten wie Fichten und Buchen zeigen in tiefen Lagen schon heute Probleme und dürften in den kommenden Jahrzehnten nach und nach von der Bildfläche verschwinden. Wärmeliebende Arten wie die Eiche hingegen werden hier in die Bresche springen und gleichzeitig in immer höhere Gefildevorstossen.
Solche Verschiebungen sind sowohl in der Pflanzen- als auch in der Tierwelt zu beobachten. So gab es in Hitzeperioden bereits in der Vergangenheit immer wieder Meldungen von verendeten Fischen, die auf kühles Nass angewiesen sind. Andere…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.















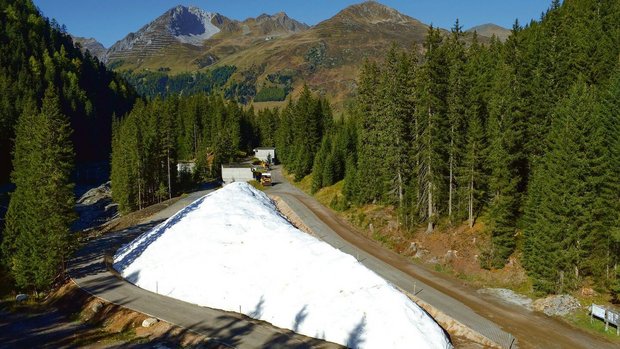





Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren