Leben im Röhricht
Schilfgürtel: Ein Refugium für Vögel und Insekten
In einem Schilfgürtel ist prima vista nichts ausser Schilf. Weit gefehlt! In diesem fein austarierten Lebensraum im Uferbereich nisten unzählige, teils höchst seltene Vögel, lauern hungrige Amphibien und blubbern Fische in allen Grössen und Farben. Ein Blick ins Verborgene.
Plötzlich schiesst etwas aus dem Schilf und ehe man sichs versieht, ist dieses Etwas auch schon wieder aus dem Sichtfeld entschwunden. «Achtung, da drüben!», ruft Stefan Heller und zeigt auf die nächste Kreatur, die jetzt zur Linken vorbeiflitzt. Der Leiter des BirdLife-Naturzentrums Neeracherried im Zürcher Unterland hält inne, lauscht und nickt: «Es ist der Teichrohrsänger.» Der rund 13 cm grosse Vogel gilt als Schilfbewohner par excellence: Mit seinen langen kräftigen Zehen kann er sich mühelos an die senkrechten Halme klammern. Ebenso gerissen: Dank des unprätentiösen braunen Gefieders verschmilzt er optisch mit seiner Entourage und entzieht sich so feindlichen Blicken.
«Der Teichrohrsänger ist der Rapper im Schilf», sagt Heller schmunzelnd. In der Tat: Sein rhythmischer, langgezogener Singsang übertönt sogar das Flugzeug, welches in diesem Moment über dem Naturschutzgebiet zur Landung in Kloten ansetzt. Die unverkennbaren Soundeinlagen machen auch die ornithologische Bestimmung…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 12 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.
















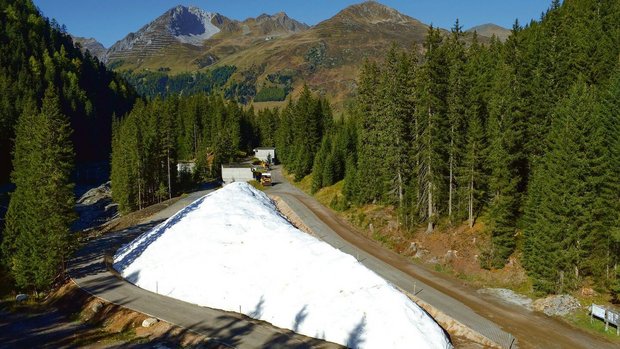






Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren