Anbau von Brunnenkresse
Schweizweit einzige Brunnenkressekultur
Willkommen in einer anderen Welt, willkommen im oberaargauischen Wynau: Lange Betonbecken ziehen sich mitten durch eine Naturoase – wie ein grüner Teppich wächst hier seit 1905 Brunnenkresse. Der landesweit einzige Ort, an dem das Blattgemüse kultiviert wird.
Die schmale Strasse, die Ausgangs Roggwil (BE) von der Eisenbahnbrücke links abbiegt, verläuft noch einige Hundert Meter entlang der Bahnschienen, bevor sie unvermittelt in einem grünen Paradies endet. Eingangs des Naturschutzgebietes Mumenthaler Weiher-Brunnmatte taucht ein älteres beiges Haus auf, direkt dahinter erstrecken sich lange Betonbecken, die mit dem Grün ringsum zu verschmelzen scheinen. Ein einziger roter Farbtupfer bewegt sich mitten durch das grüne Meer. Ausgestattet mit hohen Fischerstiefeln watet Silvia Merz im roten T-Shirt in gebückter Haltung durch eines dieser Becken. Mit einer Rasenschere schneidet sie die festen rundlichen Blätter der Brunnenkresse (Nasturtium officinale), die sich wie ein Teppich über das Wasser legt, ab und sammelt sie in einem Einkaufskorb.
[IMG 2]
50 bis 60 Kilogramm der aromatischen, ja gar leicht scharfen Pflanze, die nur in fliessendem, sauberem und mineralreichem Quellwasser gedeiht, erntet die Betriebsleiterin der BrunnBachKresse GmbH…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.











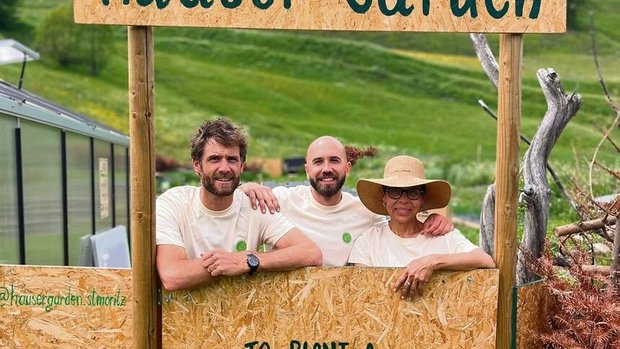










Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren