Der Grosi-Effekt
Warum Frauen so lange leben
Menschen werden im Vergleich zu anderen Säugetieren überdurchschnittlich alt. Während Weibchen anderer Arten sich bis zu ihrem Lebensende fortpflanzen können, kommen Frauen jedoch spätestens mit 50 in die Menopause. Eine mögliche Erklärung dafür ist der Grosi-Effekt.
Was unterscheidet Menschen-Frauen von den Weibchen anderer Menschenaffen? Nein, das ist nicht der Beginn eines sexistischen Witzes, sondern eine Frage, mit der sich unter anderem die biologische Anthropologie beschäftigt. Tatsächlich mag die Antwort überraschen.
Während auch Männer sich durch ihre Sprache, die Kultur und den Mangel an Fell von Affen unterscheiden, so sind sie doch wie ihre wilden Verwandten nach der Pubertät ihr ganzes Leben lang fruchtbar. Nicht so die Frauen. Diese kommen ab einem bestimmten Alter in die Menopause, leben danach in der Regel aber noch viele Jahre. Bei den meisten anderen Säugetieren ist dies nicht der Fall.
Im Laufe der Evolution setzen sich nur jene Merkmale durch, die für ein Individuum von Vorteil sind. Was nicht gebraucht wird, bildet sich über die Generationen zurück, um keine unnötigen Ressourcen zu verschwenden. So verlor der moderne Mensch seinen Affenschwanz und das Fell, und auch unsere grossen Zehen sind nicht mehr zum Klettern geeignet. Während sich die meisten Säugetiere bis zum Ende ihres Lebens fortpflanzen können, ist dies bei Menschen – zumindest bei Frauen – nicht der Fall.
Evolutionsbiologen stellen sich schon länger die Frage, warum sich bei Frauen eine im Verhältnis zur hohen Lebenserwartung relativ früh einsetzende Unfruchtbarkeit entwickelte. Denn im Vergleich zu Artgenossinnen, welche bis zu ihrem Lebensende Kinder bekommen könnten, wären die Frauen mit Menopause aufgrund der geringen Fortpflanzungsrate evolutiv im Nachteil gewesen. Welchen Sinn hat die Menopause also?
Mehr spannende Artikel rund um Tiere und die Natur?Dieser Artikel erschien in der gedruckten Ausgabe Nr 06/2023 vom 23. März 2023. Mit einem Schnupperabo erhalten Sie 6 gedruckte Ausgaben für nur 25 Franken in Ihren Briefkasten geliefert und können gleichzeitig digital auf das ganze E-Paper Archiv seit 2012 zugreifen. In unserer Abo-Übersicht finden Sie alle Abo-Möglichkeiten in der Übersicht.
Jetzt Schnupperabo abschliessen
Zur Abo-Übersicht
Den Enkelkindern zuliebe
Tatsächlich ist der Mensch nicht das einzige Tier, bei dem Individuen mit dem Alter unfruchtbar werden. Von Zoos ist bekannt, dass auch Rhesusaffen-, Schimpansen- und Elefantenweibchen eine Menopause durchlaufen. In der freien Wildbahn geht damit aber auch eine deutliche Verschlechterung der Gesundheit einher, weswegen die meisten Individuen kurz darauf sterben. Einzig bei Zahnwalen wie dem Schwertwal, dem Kurzflossen-Grindwal, dem Beluga und dem Narwal wurden auch bei frei lebenden Tieren eine Menopause nachgewiesen. Entsprechend ist es offenbar nicht nur das «Menschsein» an sich – mit all seinen Annehmlichkeiten, wie etwa einer medizinischen Versorgung –, das die Menopause ermöglicht oder sinnvoll macht. Der Grund muss tiefer liegen.
[IMG 3]
Eine Theorie besagt, dass Grossmütter für ihre Grosskinder evolutionär vorteilhaft sind. Sich um die Kindeskinder statt um eigene weitere Kinder zu kümmern, könnte ein Grund sein, weshalb sie ab einem gewissen Alter keinen Nachwuchs mehr bekommen. Ausserdem sind gerade Menschenkinder im Vergleich zu anderen Säugetieren länger und in einem höheren Masse abhängig von Erwachsenen. Entsprechend gering wäre die Überlebenschance des Kindes einer späten Mutter, wenn diese altersbedingt sterben würde, bevor das Kind die Selbstständigkeit erreicht hat.
Die Unfähigkeit, im späteren Leben Kinder zu bekommen, sichert also auch das Überleben des Nachwuchses. Und sollte dieser selber Kinder bekommen, so steht das erfahrene Grosi zur Seite. Dies tut sie nicht nur aus reiner Nächstenliebe, sondern auch aus egoistischem Interesse: Durch die Enkel wird schliesslich ein Teil ihrer Gene verbreitet. Verschiedene Studien bestätigen diesen Grosi-Effekt. Daten aus historischen Bevölkerungsregistern verraten, dass lebende Grossmütter einen positiven Effekt auf den Nachwuchs haben. Unsere hohe Lebenserwartung als Menschen haben wir also wahrscheinlich auch der fürsorglichen Unterstützung unserer Grossmütter zu verdanken.
Und bei den Walen? Bei allen Arten mit Menopause sind es die Mütter mit ihren Jungen, die konzentrierte Gruppen bilden. Wenn ein Weibchen immer weiter Nachwuchs bekommen würde, so würde dies die Konkurrenz untereinander verstärken. Aus evolutionärer Sicht ist es daher sinnvoller, wenn Weibchen nacheiniger Zeit unfruchtbar werden und sich quasi in den Dienst der Familie stellen.
Das Wissen der älteren Weibchen, zum Beispiel, wo die besten Futterplätze sind, hilft der Gruppe und damit den Nachkommen ihres Nachwuchses, zu überleben. Auch bei Afrikanischen Elefanten schliessen sich mehrere Mütter mit ihren Jungtieren zu Herden zusammen, in denen die Individuen miteinander verwandt sind. Ältere Geschwister, Tanten und Grossmütter kümmern sich dabei zusammen mit den Müttern um die Aufzucht der Jungtiere.
[IMG 2]
Im Umkehrschluss ist es jedoch keinesfalls so, dass die Sozialstruktur alleine bestimmt, ob Weibchen einer Art in die Menopause kommen. Viele Faktoren sind noch nicht erforscht, und wie so oft in der Evolution entscheidet schlussendlich das Gleichgewicht zwischen den vielen Vor- und Nachteilen darüber, welche Merkmale sich durchsetzen. Eins ist aber sicher: Unsere Grosis sind unverzichtbar!




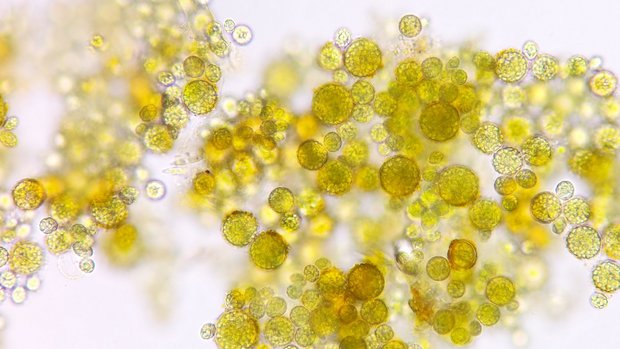





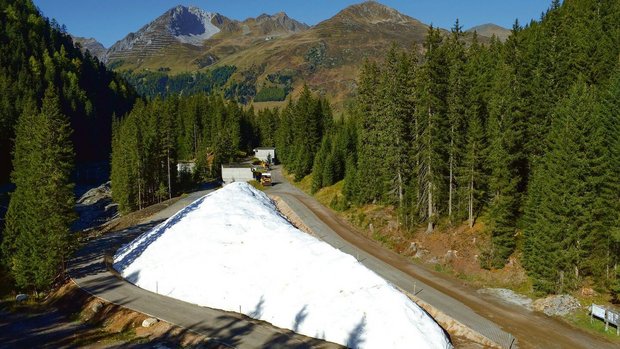







Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren