Fokus
Wiesen in luftiger Höhe
Vor über 30 Jahren wurden in der Schweiz die ersten Flachdächer begrünt. Heute ist das Begrünen vielerorts Pflicht. Das wird zwar nicht die Welt retten. Nützen tut es trotzdem.
Würde man alle Flachdächer der Schweiz zusammenlegen, könnte man damit knapp den Kanton Obwalden zudecken. Und der ist ganze 491 Quadratkilometer gross. «Das ist aber nur eine sehr grobe Schätzung», sagt Stephan Brenneisen, Leiter Stadtökologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Genau wisse man das nicht. Ebenso wenig sei bekannt, wie gross der Anteil an Gründächern ist. Mit Ausnahmen. «In Basel ist ein Drittel aller Flachdachflächen begrünt. So viel wie in keiner anderen Schweizer Stadt.» Schaut man die Gründachnutzung pro Kopf an, ist Basel laut einer US-Studie von 2012 sogar weltweit führend.
Flachdächer naturnah zu bepflanzen, ist mittlerweile gang und gäbe. Bei Neubauten oder Sanierungen ist eine Begrünung mancherorts sogar zwingend. Dafür sorgen Bau- und Zonenordnungen. «Wobei einige Gemeinden eine Begrünung ab 20, andere erst ab 100 Quadratmeter Dachfläche und wieder andere überhaupt keine Begrünung verlangen», sagt Brenneisen. Auch fehlten Mindestvorgaben für die Dicke der Substratschicht. Immerhin: Vor vier Jahren publizierte der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein mit der Norm «Begrünung von Dächern» erstmals einen national anerkannten Qualitätsstandard – 30 Jahre nach den ersten Pilotgründächern in der Schweiz.
Ein Tropfen auf den heissen Stein
Gründächer haben mehrere Funktionen. Die wohl offensichtlichste ist, dass sie als ökologische Ausgleichsflächen in Städten, Agglomerationen und Industriegebieten dienen. Als grüne Inseln in einem Meer aus Beton und Asphalt. Das Verbauen und Versiegeln einstiger Lebensräume ist nicht der einzige Grund, der dies nötig macht. «Die intensive Landwirtschaft in der Peripherie bereitet der Tier- und Pflanzenwelt genauso Schwierigkeiten», sagt Brenneisen.Monokulturen, Kunstdünger, Pestizide und andere Faktoren sind denn auch seit Längerem mit dafür verantwortlich, dass Arten sogar aus ländlichen Gebieten verdrängt werden.
Trotzdem sind Gründächer nur ein Tropfen auf den heissen Stein. «Diese Form von Biodiversitätsförderung ist sicher wichtig, aber sie wird das grundsätzliche Biodiversitätsproblem nicht lösen», sagt Brenneisen. Auch wenn alle Flachdächer der Schweiz als Grünflächen genutzt würden, könnte man damit den anhaltenden Artenrückgang nicht stoppen. Ebenfalls skeptisch steht er dem Konzept gegenüber, begrünte Dächer könnten Lebensräume miteinander vernetzen und damit eine Art Grünkorridor für wandernde Tiere sein. «Tiere, die es auf Dächer hinaufschaffen, sind schon von Natur aus höchst mobil», sagt Brenneisen. Diese Art von Nutzen sei deshalb fraglich.
Kiebitze als Biodiversitätsindikator
Zusammen mit seinem Team erforscht Brenneisen bereits seit vielen Jahren die Wirkung und den Nutzen von begrünten Dächern. Ein mittlerweile abgeschlossenes Projekt befasste sich zum Beispiel mit der Frage, inwiefern Gründächer einen alternativen Lebensraum für bodenbrütende Vögel darstellen könnten, insbesondere für den bedrohten Kiebitz.
Dazu wurden sechs Standorte evaluiert. Einer davon liegt im Industriegebiet von Emmen im Kanton Luzern, auf den Dächern einer grossen IT-Logistikfirma. Dort schafften es die ZHAW-Forscher, die bereits begrünten Dachflächen von drei Gebäuden so zu optimieren, dass sich darauf eine brütende Kolonie etablierte, die regelmässig vier bis sieben Junge pro Jahr aufzieht.
Bei einem Besuch Anfang Juli ist von den Kiebitzen aber nichts mehr zu sehen. Sie sind längst ausgeflogen. Dafür hat die anhaltende Sommerhitze ihre Spuren hinterlassen. Auf einem der Dächer liegen die meisten Gräser und Kräuter verdorrt darnieder. Immerhin finden sich einige Farbtupfer: kleine Gruppen von Weissem und Scharfem Mauerpfeffer, ein rosa blühender Thymianstrauch, ein paar Flockenblumen mit lilafarbenen Blüten. Etwas besser sieht es auf dem Nachbargebäude aus. Um einen künstlich angelegten Mini-Teich spriesst dort grünes Gras. Eine kleine Weide spendet einem Ahornsprössling Schatten. Daneben wuchert wilder Schnittlauch.
Was man an den Kiebitzen ablesen kann
Um bei den Kiebitzen zu bleiben: Sie sind ein guter Indikator dafür, wie viel Leben es effektiv auf einem begrünten Dach gibt. Da Kiebitze Nestflüchter sind, müssen sich die Jungen ihr Futter selbst besorgen. Also Insekten und Spinnen. «Es hat sich gezeigt, dass es davon auf Dächern oft zu wenig gibt», sagt Brenneisen. Viele Jungen verhungern deshalb. An einen günstigeren Ort wechseln können die Tiere ja nicht. Spätestens am Dachrand ist für die Küken Schluss.
Grund für den Nahrungsmangel ist oft eine zu dünne Substratschicht. Acht Zentimeter sind die Norm. Ideal wären laut Brenneisen aber zwölf oder sogar mehr. «Darüber lässt sich streiten. Unbestritten ist jedoch: Je dicker die Substratschicht, desto mehr Wasser kann ein Dach speichern und desto dichter ist die Vegetation.» Wobei Letzteres auch davon abhängt, was man aussät und was am Ende natürlicherweise aufs Dach kommt. Der Biotop-Typ selbst variiert je nach Standort. Ist es schattig und feucht, kann die Dachbegrünung sumpf- bis flachmoorartig sein. Ist es sonnig und trocken, geht es in Richtung Trockenwiese oder Steppe.
Temperaturunterschiede von 20 Grad
Um den Kiebitzen genug Nahrung zu verschaffen, bauten die ZHAW-Forscher kleine Hügel. Zudem integrierten sie Strukturelemente wie Holzhaufen, Steinhaufen und legten Miniteiche an. All dies lockt – zusammen mit den richtigen Blumen und Kräutern – mehr Insekten an, darunter Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Heuschrecken, Ameisen und Wasserläufer. Hinzu kommen flugfähige Spinnen, die sich an ihrem seidenen Faden hängend durch die Luft tragen lassen. Bodenlebewesen wie Regenwürmer und Asseln, die es lieber feucht haben, finden sich eher selten auf einem Dach; das gilt auch für Milben und Springschwänze. Und wenn, dann wurden sie eingeschleppt. Etwa mit dem Substrat. Kletterpflanzen an der Wand eines Gebäudes können ebenfalls gewissen Tieren den Zugang ermöglichen.
Gründächer dienen nicht nur der Natur. Sie sollen im Sommer auch das Klima im Siedlungsgebiet verbessern. Das Wasser, das im Substrat gespeichert wird, aber auch jenes, das die Pflanzen über ihre Blätter verdunsten, sorgt für eine Abkühlung der Umgebungsluft. Das belegen unter anderem Studien und Modellierungen für Toronto (Kanada) und New York (USA). «Würde man in New York die Hälfte aller Dächer begrünen, könnte man damit im Sommer die bodennahen Durchschnittstemperaturen um fast 0,9 Grad senken», sagt Brenneisen.
Beachtlich ist auch, dass die Höchsttemperaturen auf New Yorks begrünten Dächern tagsüber durchschnittlich 20 Grad und in der Nacht acht Grad tiefer liegen als auf nicht begrünten. Das merkt man auch im Gebäudeinnern. «Substrat und Vegetation wirken wie eine Isolation. Im Sommer ist es drinnen kühler, im Winter geht weniger Wärme verloren», sagt Brenneisen.
Lange Lebensdauer
Gründächer haben noch weitere Umweltaspekte. Mit rund 40 Jahren Lebensdauer halten sie etwa doppelt so lange wie Kiesdächer. Durch ihre Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu speichern, fliesst weniger Regenwasser in die Kanalisation und Kläranlagen. Zudem sinkt das Hochwasserrisiko bei Starkniederschlägen. Sie verbessern die Lufthygiene, weil sie Staubpartikel und Feinstoffe filtern und binden können. Und schliesslich sorgen sie für mehr Schallschutz.
Dass Dachflächen auch landwirtschaftlich genutzt werden können, Stichwort «Urban Farming», liegt auf der Hand, ist laut Brenneisen hierzulande aber selten, weil es schlicht nicht rentiert. Höchstens als Zusatzverdienst. «Im Kanton Obwalden haben wir eine Bäuerin beraten, die auf dem Flachdach eines Neubaus Tee- und Küchenkräuter zieht und diese dann im Hoflädeli verkauft.» Dort wachsen sogar Kürbisse. Und was ist mit «Urban Gardening»? Für Brenneisen keine Neuerfindung. «Das ist ein Hype, nichts weiter», sagt er. Es bezeichne schlicht das, was viele von uns schon seit ewig machen: auf Balkon oder Terrasse Tomaten, Schnittlauch und Peterli anpflanzen.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.




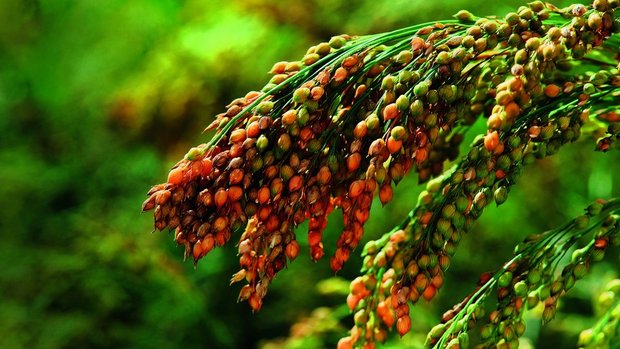



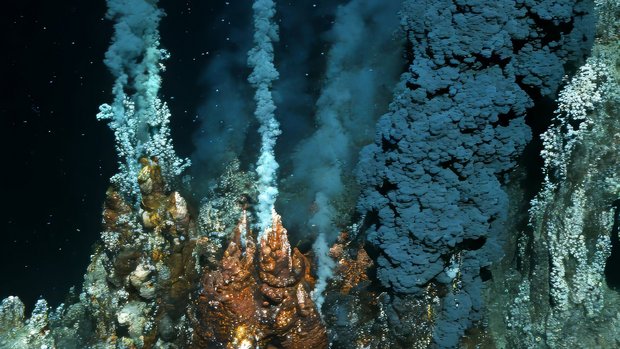

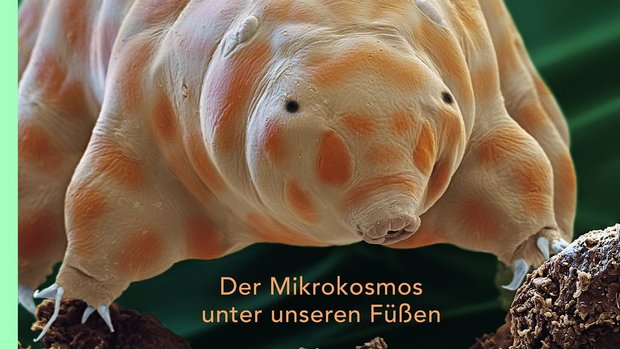




Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren