Meister Lampe
Feldhase: Das leise Verschwinden des Langohrs im Schweizer Flachland
Der Hase ist in der menschlichen Kultur tief verwurzelt. Nicht nur essen wir mit Vorliebe schokoladige Osterhasen zum Fest der Auferstehung Jesu. Auch im Sprachgebrauch, in der Kunst und in der Literatur ist das Langohr allgegenwärtig.
«Als ich damals mit 22 Jahren mit dem Jagen begann, haben wir einmal an einem einzigen Nachmittag sechs Hasen geschossen», erinnert sich Rainer Klöti. «Damals war Hase etwas Feines zum Essen, aber nichts Spezielles, nichts Rares. Bald haben wir Jäger jedoch festgestellt, dass die Hasenbestände zurückgehen, und hörten früh auf, sie zu bejagen. Noch bevor sich überhaupt jemand Sorgen um die sinkenden Bestände machte.» Der Aargauer Jäger und Facharzt für Rheumatologie greift zur Wärmebildkamera und sucht das Feld nach Meister Lampe ab. Ein gut genährter Dachs trollt auf der Suche nach Futter umher, ein Feldhase indes lässt sich nicht blicken.
Rainer Klöti ist nicht nur passionierter Jäger, sondern auch Geschäftsführer der Stiftung Wildtiere Aargau. Zusammen mit anderen aktiven Jägerinnen und Jägern setzt er sich für die Wildtiere und den Erhalt ihrer Lebensräume im Kanton Aargau ein. Das Augenmerk liegt dabei nicht nur auf den jagdbaren Tierarten. Neben Projekten wie der Rettung von…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 13 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.

















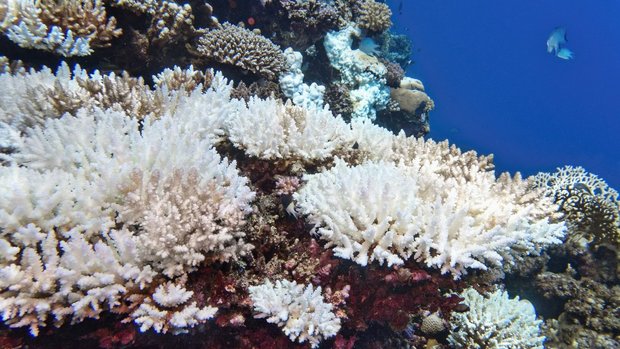






Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren