Zwischen Überleben und Trophäen
Wilderei im Visier – Frevelei rund um den Schweizerischen Nationalpark
Global bedroht die Wilderei ganze Wildtierbestände. Oft agieren Wilderer grenzüberschreitend – so auch in der Schweiz. Heinrich Haller, ehemaliger Direktor des Schweizerischen Nationalparks, hat einige historische und aktuelle Fälle von Wilderei aufgedeckt.
Später als sonst machte sich Heinrich Haller an diesem Samstagmorgen im November 2004 auf den Weg in die Höhe. Der damalige Direktor des Schweizerischen Nationalparks (SNP) beschäftigte sich schon länger mit Wilderei – von 1997 bis ins Jahr 2015 machte er insgesamt 1020 persönliche Feldbegehungen für seine Recherche. Dieser Tag war einer davon. «Natürlich hatte ich die Absicht, Spuren zu finden», sagt der Biologe. Draussen waren Sonderjäger unterwegs, um den Hirschbestand zu regulieren. Nahe der Grenze zu Italien traf er auf einen bekannten Jäger, der ihm eine seltsame Beobachtung schilderte: Zwei Männer seien frühmorgens über die Grenze in das italienische Tal Livigno vorgedrungen – ein sehr beliebtes Ziel für Wilderer. Einer der beiden Herren sei etwas später zurückgekommen, der andere nicht. «Was ist da los?», dachte sich Haller. Die Verdächtigen hatten zu Hallers Glück Spuren im Schnee hinterlassen. «Angst hatte ich keine, aber Respekt. Ich war mir des Risikos bewusst und suchte…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.

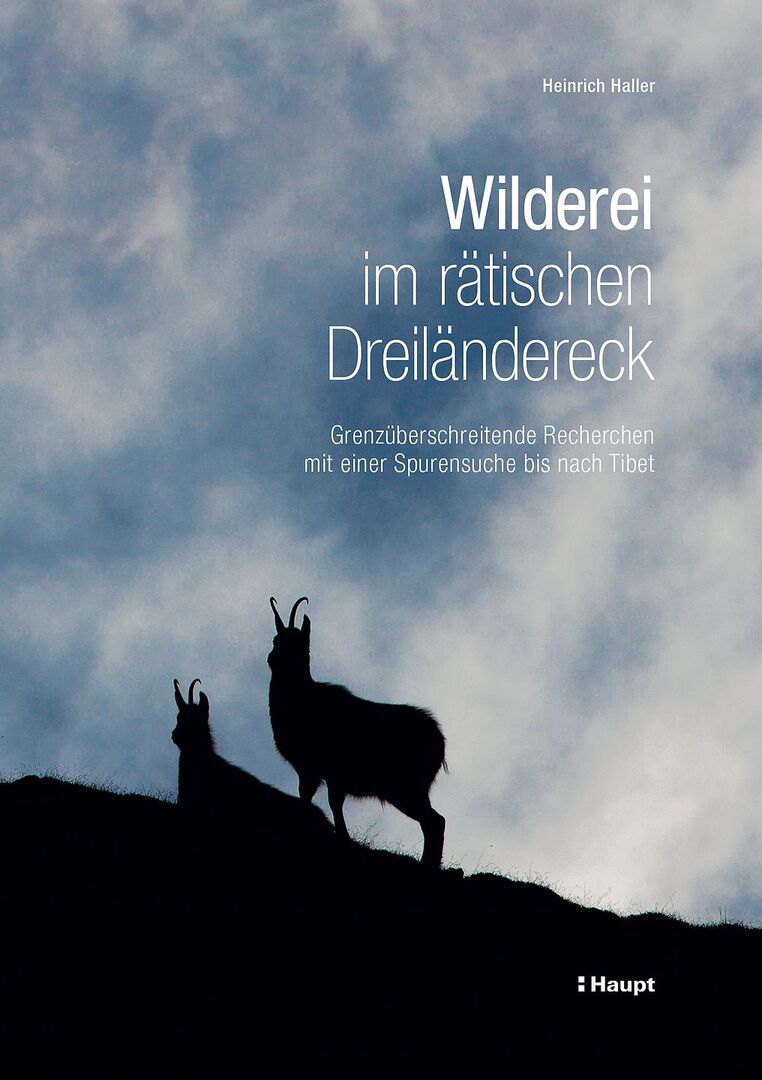















Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren