Fokus
Leben aus der Asche
Vor 16 Jahren zerstörte ein Brand bei Leuk im Oberwallis rund 300 Hektaren Bergwald. Forscher haben nachgezeichnet, wie Pflanzen und Tiere in das Gebiet zurückkehrten. Die Geschwindigkeit überraschte sie.
Kurz vor acht Uhr abends bricht das Inferno los. Ein junger Mann hat im Bannwald oberhalb Leuk im Oberwallis einen Brand gelegt. Es ist der 13. August 2003, im berühmt-berüchtigten Hitzesommer. Die Vegetation ist trocken, die Feuersbrunst breitet sich rasend schnell aus. Winde treiben sie in einem 500 bis 1000 Meter breiten Streifen hangaufwärts, bis der Brand an der Waldgrenze zum Erliegen kommt. Rund 200 000 Bäume verkohlen, drei Quadratkilometer Wald sind vernichtet. Es ist der grösste Waldbrand im Wallis seit mehr als 100 Jahren. Die Kosten für die Brandbekämpfung und zur Sicherung der steilen Hänge gegen Lawinen und Erdrutsche gehen in die Millionen.
Der Brand bringt aber nicht nur Zerstörung, sondern auch neue Chancen. Denn ein Grundgesetz der Natur lautet: Damit Neues entstehen kann, muss Altes vergehen. Das Waldbrandgebiet in Leuk habe im ersten Jahr furchtbar ausgesehen, «wie eine Mondlandschaft», sagt Thomas Wohlgemuth, Leiter der Forschungsgruppe Störungsökologie an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). «Doch dann explodierte das Leben.»
Farbenprächtige Blütenmeere
Zusammen mit seinem Team untersucht Wohlgemuth, wie die Natur auf den Brand reagiert. Welche Pflanzen die aschebedeckten Flächen besiedeln, was für Tiere sich einfinden – wie lange es dauert, bis wieder Wald entsteht. Das Tempo dieser Rückeroberung ist eindrücklich: Das Rote Seifenkraut bildete schon ein Jahr nach der Katastrophe farbenprächtige Teppiche. Ab dem zweiten Jahr verwandelten das rote Wald-Weidenröschen und der gelbe Färberwaid grosse Teile in ein Blumenmeer. Diese Pioniere profitierten nicht nur vom plötzlich vorhandenen Licht, sondern auch von der nährstoffreichen Asche, wie Wohlgemuth sagt. «Die Weidenröschen waren im dritten Jahr oft bis zu zwei Meter gross, normalerweise werden sie etwa halb so hoch.»
Auffällig früh besiedelte auch das Wetteranzeigende Drehmoos stark verbrannte Stellen – und ab dem dritten Jahr fand sich auf 80 Prozent der Untersuchungsflächen der Erdbeerspinat, eine Kulturpflanze, die längst nicht mehr angebaut wird und deren Samen über Jahrzehnte im Boden überdauerten. Im Jahr 2006, drei Jahre nach dem Brand, war die Pflanzenvielfalt auf den versengten Flächen bereits deutlich grösser als im intakten, ursprünglichen Wald.
Nicht nur Pflanzen, auch Tiere profitierten von dem Waldbrand. Ein WSL-Team fing zwei, drei, fünf und zehn Jahre nach dem Feuer Asseln, Spinnen, Käfer, Wanzen, Bienen und Wespen, Schwebfliegen sowie Netzflügler im Brandgebiet und im angrenzenden Wald. Insgesamt zählten die Wissenschaftler 1923 Arten, wobei die Artenzahl im Brandgebiet deutlich höher war als im Wald – und zwar für jede Artengruppe und in jedem
Untersuchungsjahr.
Ein Hort für den Gartenrotschwanz
Das sei nicht weiter überraschend, sagt der Waldinsektenspezialist Beat Wermelinger, der an den Untersuchungen beteiligt war. «Wir stellen dasselbe auch nach anderen Störungen fest, zum Beispiel nach Windwurf.» Mit den neu aufkommenden Pionierpflanzen entstehen nämlich vielfältige Nahrungsangebote für Insekten: Weiche Blätter sind ein Festmahl für unzählige Larven, am Nektar und am Pollen laben sich viele adulte Tiere.
Nicht zu vergessen die abgestorbenen, verkohlten Bäume. Sie ziehen eine Vielzahl von Käfern an, deren Larven sich von Totholz ernähren – darunter auch solche, die sich auf feuerversehrte Lebensräume spezialisiert haben (siehe Text Seite 14). In Leuk habe dies für schöne, etwas surreale Bilder gesorgt, sagt Wermelinger. «Auf der Suche nach solchen Larven haben Spechte unzählige Löcher in die verkohlte Rinde von Bäumen gehackt – es sah aus wie ein schwarz-weisses Mosaik.»
Neben Spechten profitieren auch viele Vogelarten, die offene Bodenstellen benötigen, auf denen sie Insekten erbeuten. Das beste Beispiel sei der Gartenrotschwanz, sagt Livio Rey, der an der Universität Bern in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach die Vogelvielfalt auf der Waldbrandfläche in den Jahren 2006 bis 2016 untersucht hat. Von dem ansonsten in der Schweiz selten gewordenen Vogel zählten Rey und seine Kollegen pro Jahr im Durchschnitt 55 Reviere. «Das ist schweizweit die höchste Siedlungsdichte.»
Überrascht hat Rey, wie schnell die Vogelarten reagiert haben. Drei Jahre nach dem Brand zählte er zum Beispiel bereits 31 Reviere der Zippammer, die sonst oft in Weinbergen brütet. Oder zehn Steinrötel, eine Art, die felsiges Offenland liebt. Allerdings gab es auch Arten wie den Wendehals, die ein paar Jahre länger brauchten, bis sie die Waldbrandfläche besiedelten.
Naturschutz mit dem Feuerzeug?
Überhaupt hinterliess das Feuer einen neuen Lebensraum, der sich äusserst dynamisch verändert. Die prachtvollen Blumenteppiche verschwanden schon nach einigen Jahren wieder – es breiteten sich Gräser aus, später Büsche und heute an manchen Orten wieder die ersten Bäume. Parallel dazu nahm auch die Vielfalt typischer Blütenbesucher wie Bienen oder Schwebfliegen schon wenige Jahre nach dem Brand wieder ab. Auch Vogelarten kommen und gehen. Der Bestand des Steinrötels etwa ging schon ab 2006 wieder zurück. Dafür breiteten sich in den letzten Jahren Arten wie die Kohlmeise oder der Berglaubsänger aus, die von der einsetzenden Verbuschung profitieren.
Wie lange es noch dauern wird, bis auf dem Brandgebiet wieder ein Wald steht, kann niemand sagen. Doch wenn er da sein wird, werden all jene Insekten- und Vogelarten weitergezogen sein, die viel Licht, viele Blumen und offenes Gelände benötigen. Einfach wird ihre Suche nach neuen Lebensräumen nicht. Denn lichte Wälder und offene Bodenstellen sind in der Schweiz eher selten geworden.
Können Waldbrände also aus der Sicht der Biodiversität gar ein Gewinn sein? Durchaus, findet Livio Rey. Er stellt sogar zur Debatte, kontrollierte, lokale Feuer als Naturschutzmassnahme einzusetzen. In den borealen Wäldern Skandinaviens oder in Mittelmeer-Strauchlandschaften kenne man dieses Mittel bereits, sagt er. «Natürlich geht es nicht darum, einfach planlos Feuer zu legen, sondern unter strengster Aufsicht ein bestimmtes Waldstück abzubrennen.» Mehr als eine Idee sei das aber noch nicht. «Dafür bräuchte es noch viel Aufklärungsarbeit, und natürlich umfangreiche Abklärungen, was die Gefahren und die gesetzlichen Vorgaben anbelangt.» Denn, auch das stellt Rey klar, bei allen Vorteilen für die Natur als Ganzes – die menschliche Sicherheit geht vor.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.













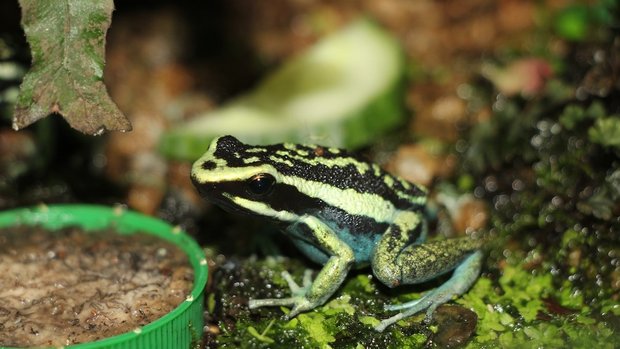












Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren