Interdisziplinäres Projekt
Tsunami-Forschung im Vierwaldstättersee
Wer härtte das gedacht: Im Vierwaldstättersee suchen Forscher seit einem Jahr Antworten auf Fragen rund um Tsunamis.
Forschungen hat es in der Vergangenheit in der Region bereits gegeben. Das vierjährige interdisziplinäre Projekt soll im Kleinen Erkenntnisse liefern, die auch für Ozeane relevant sind.
«1000 Schritt oder drei Büchsenschüsse weit», so steht es in den Schilderungen des Luzerner Stadtchronisten Renward Cysat, sei das Wasser des Vierwaldstättersees ins Landesinnere geschwappt, zwei Hellebarden hoch war die Welle damals am 18. September 1601. Beim Forschungsprojekt «Tsunamis in Schweizer Seen» treffen historische Chroniken auf Naturwissenschaft.
Breite Beteiligung
Am 2-Millionen-Franken-Unterfangen, das zum grössten Teil vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert wird, sind Wissenschaftler verschiedener Institutionen beteiligt, darunter auch die Universität Bern oder die ETH Zürich. Seit einem Jahr läuft das fünfteilige Projekt, derzeit werden vor allem Daten gesammelt, wie am Dienstag anlässlich der Präsentation in Buochs NW ersichtlich wurde.
Tsunamis entstehen in den Ozeanen etwa an Plattengrenzen, wenn sich diese verschieben und nach oben schnellen. Die darüberliegende Wassersäule hebt sich an und breitet sich in der Folge Wellenförmig aus. Nicht die Höhe sondern die Länge der Welle macht die Gefahr aus. Bei einem Tsunami kann diese mehrere Hundert Meter betragen. Das sei, sagte Flavio Anselmettti vom Institut für Geologie an der Universität Bern, wie ein langer Wasserberg, der langsam an Land rolle.
Wenn Schlamm ins Rutschen kommt
In den Seen sind es dagegen eher Schlammrutschungen, die ähnlich wie Schneebretter, spontan oder durch Erdbeben ausgelöst, sich Unterwasser bewegen und damit einen ähnlichen Effekt auslösen können. So seien beim Ereignis von 1601 rund 50 Millionen Kubikmeter solcher Sedimente ausgelöst und verteilt worden. Für eine Flutwelle brauche es denn auch Massen im Millionenkubikbereich, sagte Anselmetti.
Um mehr über vergangene Tsunamis und deren Wiederkehrrate in Schweizer Seen zu erfahren, entnehmen die Forscher in einem der Teilprojekte Bohrkerne an drei Standorten rund um den Vierwaldstättersee. Auf einem Tisch liegt eine solche braune Probe von mehreren Metern Länge, eingewickelt in Cellophan. Sie stammt aus Merlischachen SZ aus einem Torfgebiet.
In der Region schwemmte der Tsunami von 1601 Fische weit ins Landesinnere, so zumindest beschreibt es der Chronist. Laut den Forschern dürften die Ablagerungen im unteren Teil der Probe bis 12'000 Jahre zurückgehen. Analysen sollen ergeben, ob bestimmte Sedimente etwa Seekreide enthalten, das würde darauf hindeuten, dass Material aus dem See ins Landesinnere geschwemmt hat - etwa durch eine Flutwelle.
See-Sedimenten auf der Spur Im Teilprojekt mit dem Titel «Response» werden See-Sedimente seismisch und geotechnisch vermessen um herauszufinden, wie es um ihre Stabilität steht und wie sie auf Erdbewegungen reagieren. Dazu setzen die Forscher neun Ozean-Boden-Seismometer auf dem Seegrund ein. Sie wollen den Einfluss von Erdbeben auf die Hangstabilität entlang von Seeufern ermitteln.
Ungewöhnliches Vorgehen für die Schweiz
In der Schweiz sei diese Art der Untersuchung noch nie mit solch modernen Methoden vorgenommen worden, sagte Donat Fäh vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich. Überdies sei es komplex, See-Sedimente zu erforschen.
Die Gefahr, die von einem Erdbeben ausgehen kann, wird auch durch lokale Faktoren bestimmt, wie etwa die Zusammensetzung der Sedimente, deren Mächtigkeit, Dichte oder Wassersättigkeit. Ist etwa der Grundwasserspiegel nahe an der Sedimentschicht, kann sich bei Beben der Boden verflüssigen, wenn die Sedimente auseinandergedrückt werden.
Untersucht werden weiter die Unterwasserrutschungen in Deltas von Seen. Zur Erforschung von Entstehung, Ausbreitung und Modellierungen von Wellen in Seen werden einerseits Rutschungen in Wassertanks simuliert und anderseits Computermodelle erstellt. Auch der möglichen Gefährdung widmet sich ein Team. Ziel sei eine Art Mess-«Werkzeugkasten», den man für alle Schweizer Seen anwenden könne, um Risiken abzuschätzen, sagte Flavio Anselmettti.
Wunsch: einen unterirdischen Hang in die Luft zu jagen
Der Nutzen des Gesamtprojekts liege darin, das Potenzial der Messmethoden zu erforschen. Zudem erhofft man sich genauere Modelle der Sedimente sowie der Wellen und Deformationen. «Es wäre unser Wunsch gewesen, einen unterirdischen Hang in die Luft zu jagen», sagte Anselmetti. Doch das hätte wohl niemand bewilligt. Aber auch so sei der See ein perfektes Modell, ein kleines Beispiel eines Ozeans, den man besser studieren könne.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



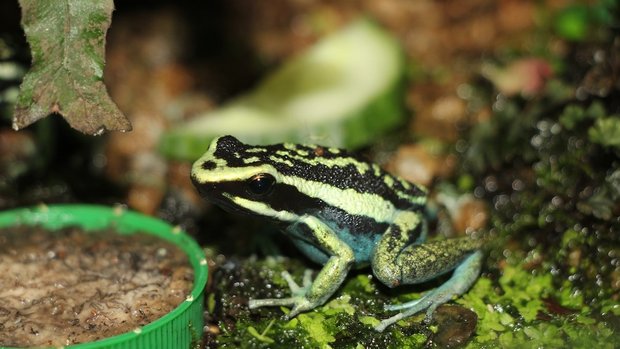











Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren