Schnell, heimlich - oft unsichtbar
Viele Rätsel um Waldmäuse
Von den hundert einheimischen Säugetierarten sind ein Drittel Mäuse. Auch die Gelbhals-, Wald- und Alpenwaldmaus gehören dazu. Näheres zu drei verwandten Heimlichtuern.
Sie sind klein, braun und oft wie ein Pfeil unterwegs: Mäuse. Dieser Begriff ist alles, was gemeinhin über die Kleinnager gesagt wird, im Gegensatz etwa zu den Vögeln, wo genau unterschieden wird. Dabei gibt es auch bei den kleinen Felltieren viele verschiedene Arten.
Man wird den Eindruck nicht los: Über Giraffen und Löwen in der afrikanischen Savanne ist mehr bekannt als über einheimische Waldmausarten. Das stimmt nur teilweise, denn der Biologe Thomas Briner bringt Licht ins Dunkel des Mäuselebens. Der Leiter des Naturmuseums Solothurn räumt zwar ein: «Sie sind unscheinbar, oft in der Nacht unterwegs, irgendwo in einer Streuschicht oder auf Bäumen.» Doch er ist den Kleinnagern aber hartnäckig auf der Spur. So hat er seine Doktorarbeit über Feldmäuse verfasst. Und weil sie so schwer zu sehen sind, dass kaum Bestandeserhebungen gemacht werden können, hat er später sogar Katzen für sich arbeiten lassen. In den Kantonen Solothurn und Bern wurden Katzenhalter aufgefordert, die Mäuse, die ihr Stubentiger erbeutet hat, im Naturmuseum abzugeben. Das brachte etwas Licht ins Dunkel um die Kleinnager. Das Projekt «Zeig mir deine Maus, Katze» habe bereits Nachahmer gefunden.
Unter 759 im Zeitraum zwischen 2018 und 2019 durch Katzen erlegten Mäusen waren 61 Gelbhals- und 95 Waldmäuse. «Das zeigt uns einerseits, dass diese Arten häufig sind und andererseits, dass sie dort vorkommen, wo auch Hauskatzen leben», sagt Thomas Briner. Zum Beispiel in einem Berner Vorort entlang eines Bachlaufs.
Ein früher Abend im Dezember, es ist schon dunkel. Der Bach rauscht, Nebel schleichen um das fahle Licht der Strassenlampen, die einen geteerten Gehweg beleuchten. Plötzlich huscht ein Schatten vorbei, klettert am Metallgeländer hoch, das den Fussgängern Schutz bietet vor dem tief unten dahinschiessenden Wasser. Oben auf dem Handlauf zeigt sich nun eine zierliche Maus mit hellbraunem bis gelblichem Fell und weissem Bauch. Ob sich auf der Brustzeichnung ein gelblich-bräunliches Band abzeichnet, kann im Dunkel nicht ausgemacht werden. Sicher aber sind der weisse Bauch und der unbehaarte, lange Schwanz erkennbar. Markante Ohrmuscheln, Knopfaugen und Schnauzhaare sind zu sehen, als das Tierchen in Richtung Bach, der in der Tiefe braust, schnuppert. Was will die Maus?
Sie setzt ihre Füsschen auf Weidenzweige, die vom gegenüberliegenden Bachufer zum Geländer ragen. Offenbar taxiert sie die Hilfsbrücke als zu wacklig, denn sie lässt die Äste zurückschnellen, trippelt am Handlauf weiter, testet wiederum. So geht das einige Zeit hin und her, bis sie offenbar die richtige Dicke erwischt hat. Behände füsselt sie dem dünnen Ast entlang, den Schwanz sicherheitshalber um den Zweig geringelt. Die Maus verschwindet im Dunkel der Äste, zurück bleiben Nebel, Kälte und das Rauschen des Wassers.
[IMG 2]
Verschiedene soziale Systeme
«Es ist gut möglich, dass es sich da um eine Gelbhalsmaus gehandelt hat», sagt Thomas Briner. Waldmäuse würden sich nämlich die dritte Dimension erschliessen. «Sie klettern auf Bäume, um an Blüten, Früchte, Insekten oder Nüsse zu gelangen. Vielleicht schlafen sie sogar in Baumhöhlen», mutmasst der Mäusekenner. Er gibt zu bedenken, dass es sich bei der Beobachtung genauso gut um die Waldmaus gehandelt haben könnte. «Beide Arten kommen in gleichen Lebensräumen vor, haben das gleiche Nahrungsspektrum und unterscheiden sich äusserlich nur wenig.» Um eine sichere Artbestimmung zu machen, greifen selbst Experten auf die Methode der DNA-Sequenzierung zurück. Es sei nicht bekannt, dass die beiden Arten in der Natur hybridisieren würden.
«Möglicherweise kommt die Maus innerhalb einer Woche wieder an gleicher Stelle vorbei», vermutet Thomas Briner. Freilandbeobachtungen von Mäusen, wie man sie von Grosssäugetieren kenne, seien aber nicht möglich. «Wir sehen sie immer nur während kurzer Momente und können ihnen nicht nachgehen.» Thomas Briner weiss aber, dass sich Waldmäuse auf mehreren Hektaren aufhalten. Es gebe verschiedene soziale Systeme. «Jungmäuse sind einige Zeit mit der Mutter unterwegs, dann leben sie ziemlich selbstständig in einer Metapopulation.» Sie seien im Zusammenleben eher variabel. «Es gibt Kämpfe zwischen dominanten Männchen, die Reviere besetzen», erzählt der Forscher.
Weibchen würden ab April mehrfach Junge gebären. «Die Überlebensrate reicht von wenigen Monaten bis zu höchstens zwei Jahren.» Waldmäuse hätten einen grossen ökologischen Wert. Sie dienten Fuchs, Marder, Wiesel, Eulen, Raubvögeln, Störchen und Reihern als Nahrung, würden Insekten vertilgen und Samen verbreiten.
[IMG 3]
Nahe dem Beobachtungspunkt der Gelbhalsmaus befinden sich Wohnblöcke. Dort wühlen sich Mäuse durch die Isolationsschicht zwischen den Platten und der Mauer. «Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei auch um Gelbhals- oder Waldmäuse, denn die Hausmaus ist selten geworden», konstatiert Thomas Briner. Wie komplex die Mäusesituation ist, zeigt sich vollends, als Thomas Briner erwähnt, dass sich im Graubünden die Gelbhals-, Wald- und Alpenwaldmaus am gleichen Ort begegnen könnten. Wahrlich, bei Giraffe und Löwe ist es einfacher. Faszinierend, welche Fragen sich direkt vor der Haustüre auftun.
Waldmäuse der SchweizGelbhalsmaus (Apodemus flavicollis)
Waldmaus (Apodemus sylvaticus)
Alpenwaldmaus (Apodemus alpicola)















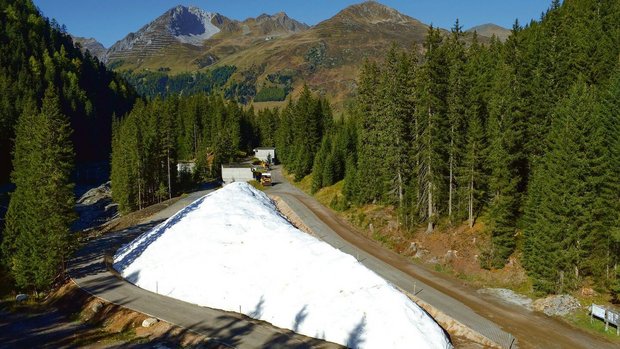


Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren