Zersiedelungsinitiative
Die Schweiz soll nicht zugebaut werden
Die Baufläche in der Schweiz soll begrenzt werden. Das fordern die Jungen Grünen mit der Zersiedelungsinitiative. Gewerbevertreter halten die Initiative aber für zu radikal.
Jeden Tag werde in der Schweiz eine Fläche von acht Fussballfeldern verbaut, sagte Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen, vor den Medien in Bern. Jede Sekunde gehe ein Quadratmeter Grünfläche verloren. Mit der Initiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung» (Zersiedelungsinitiative) soll diese Entwicklung gestoppt werden. Am 10. Februar wird über die Initiative abgestimmt. Bei einem Ja müssten Neueinzonungen von Bauflächen durch Rückzonungen an einem anderen Ort kompensiert werden. Die Bauzonen würden nicht eingefroren, sagte Franzini. Sie könnten dorthin verschoben werden, wo sie gebraucht würden. Heute bestünden Baulandreserven von 400 Quadratkilometern.
Wie der Mechanismus zur Kompensation genau ausgestaltet werden soll, lässt die Initiative offen. Den Initianten schwebt vor, dass Gemeinden Bauland untereinander abtauschen könnten. Entsprechende Instrumente würden in einzelnen Kantonen bereits entwickelt, halten sie fest.
Einen ähnlichen Mechanismus bräuchte es auf Bundesebene, damit die Kompensation über die Kantonsgrenzen hinaus möglich wäre, sagte Bastien Girod, Nationalrat der Grünen (ZH). Das Parlament würde bei der Umsetzung mit Sicherheit dafür sorgen, dass regionale Entwicklung möglich bliebe.
Raumplanungsgesetz ungenügend
Fest steht für die Initianten, dass das revidierte Raumplanungsgesetz nicht genügt, um die Zersiedelung zu stoppen. Zwar werde in gewissen Kantonen weniger zerstreut gebaut, namentlich im Wallis, sagte Girod. Die Verbauung von Grünflächen gehe aber ungebremst weiter, insbesondere im Mittelland.
Gemäss dem geltenden Gesetz dürfe nämlich neues Land eingezont werden, sobald für einen Planungshorizont von 15 Jahren Bedarf an Bauland nachgewiesen werde. Auch die geplante nächste Gesetzesrevision sei keine Alternative zur Initiative.
Mit dem heutigen Parlament bestehe vielmehr die Gefahr, dass das Bauen ausserhalb der Bauzonen weiter vereinfacht und jedes Maiensäss in einen Ponyhof umgebaut werde, sagte Girod. Bei einem Ja zur Initiative dürften ausserhalb der Bauzone ausschliesslich Bauten für die bodenabhängige Landwirtschaft oder von öffentlichem Interesse bewilligt werden.
Ausserdem würde in der Bundesverfassung verankert, dass nachhaltige Formen des Wohnens gefördert werden. Der effizientere und sinnvollere Umgang mit den Bauzonen werde auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt verbessern, sagte Kevin Morisod, Co-Präsident der Jungen Grünen.
Bevölkerung unzufrieden
SP-Nationalrat Thomas Hardegger (ZH) wies auf Umfragen und Abstimmungen in Kantonen und Gemeinden hin. Diese zeigten, dass die Bevölkerung unzufrieden sei mit den geltenden Regeln.
Im Kanton Zürich wurde 2012 die Kulturlandinitiative angenommen, was zu einem fünfjährigen Einzonungsmoratorium führte. «Der Kanton Zürich existiert immer noch», stellte Hardegger fest. Der Wert der eingezonten, schlecht ausgenutzten Areale habe einen höheren Stellenwert erhalten und zur effizienteren Nutzung des bestehenden Siedlungsgebietes beigetragen.
«Niemand behauptet, die Zersiedelungsinitiative wäre einfach umzusetzen», räumte Hardegger ein. Doch nur mit einem Einzonungsmoratorium würden Bundesrat und Parlament gezwungen, Kulturland und Landschaften zu schützen. Mit der Zersiedelungsinitiative werde die Notbremse gezogen.
Es seien genügend unternutzte Zonen und Industriebrachen vorhanden, die teilweise bereits gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen seien. Nötig sei jedoch eine regionale Betrachtungsweise. «Nicht jede Kleinstgemeinde braucht eine Industriezone, ein Einkaufszentrum und ein Villenviertel.»
Markus Schwegler von der Kleinbauern-Vereinigung wies auf den Wert des Bodens für die Lebensmittelproduktion und die Ökosysteme hin. Die Initiative wird auch von Umweltverbänden wie Pro Natura, VCS oder Greenpeace unterstützt. Der Schutz des Kulturlandes sei keine Frage von links oder rechts und auch keine Frage von Stadt oder Land, sagte Franzini. Dafür zu sorgen, dass die Schweiz in 30 Jahren nicht zugebaut und grau sei, entspreche schlicht dem gesunden Menschenverstand.
Wirtschaftsvertreter nicht erfreut
«Niemand ist für Zersiedelung», sagte Corinne Aeberhard, Kampagnenleiterin beim Schweizerischen Gewerbeverband (sgv), an der Medienkonferenz der Gegner der Initiative am Dienstag in Bern. Die Initiative sei jedoch radikal und entwicklungshemmend. Ein starrer Bauzonen-Stopp lasse die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft ausser Acht.
Der jungfreisinnige Unternehmer Leroy Bächtold warnte vor einem Raumplanungswettbewerb zwischen den Kantonen. Zudem könnten Unternehmen ins Ausland abwandern – oder von städtischen in ländliche Gebiete, da letztere noch unerschlossene Bauzonen hätten. Gegenteilige Befürchtungen hegt Christine Bulliard-Marbach, Freiburger CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Berggebiete: Der Anreiz zur Landflucht in Richtung Ballungszentren des Mittellandes würde sich dramatisch erhöhen, sagte sie.
Dass Gemeinden oder Kantone ohne Baulandreserven das Recht auf Neueinzonungen von Gemeinden oder Kantonen mit Reserven erwerben könnten, ändert für die Gegner nichts. Würde im Wallis Bauland ausgezont, damit in Zürich Neueinzonungen möglich wären, würde das den Zusammenhalt des Landes gefährden, sagte Ruppen. «Stellen Sie sich vor, was da los wäre.» So etwas sei nicht umsetzbar.
Die Thurgauer SVP-Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr sagte, es drohten Rechtsunsicherheit und «orientierungslose Zustände bei allen Beteiligten». Wer die Zersiedelung stoppen wolle, sollte sich für die Vereinfachung von Bauvorschriften in bereits bebauten Zonen einsetzen. Die Initiative aber wolle ein absolutes Moratorium. «Sie diktiert uns zentral formulierte Vorschriften, wie wir zu wohnen und zu leben haben sowie wie und wo wir arbeiten müssen.»
Aus Sicht der Gegnerinnen und Gegner stellt die Initiative auch einen «schlimmen Eingriff» in die Kompetenzen der Kantone und Gemeinden dar, wie es Bulliard-Marbach formulierte. Die Zersiedelung sei ein Problem, aber die Initiative verhindere die Suche nach differenzierten Lösungen.
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.






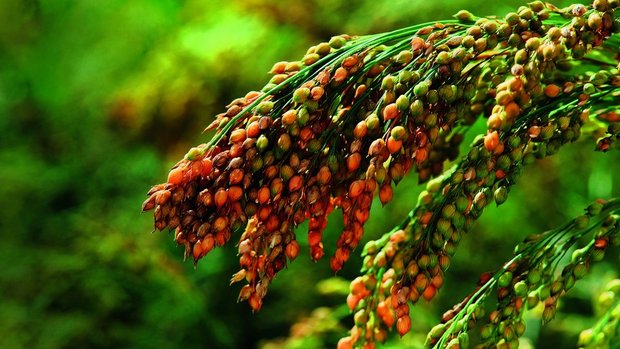



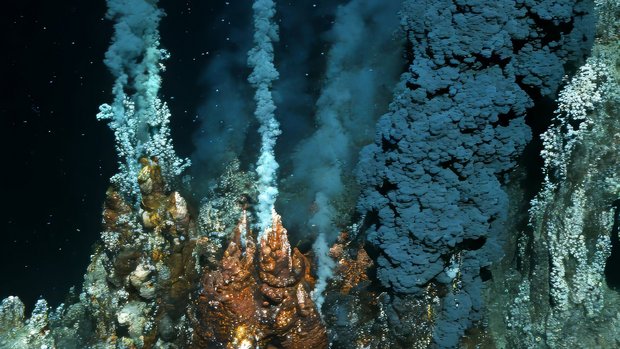

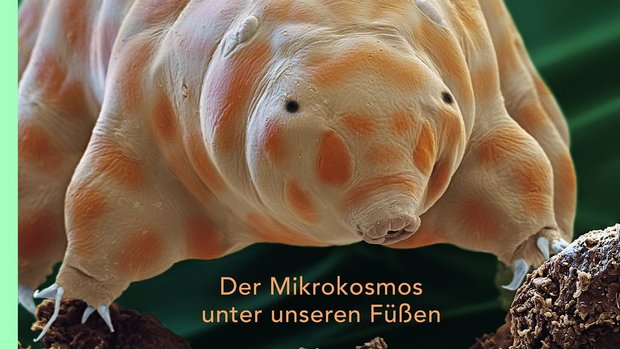


Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren