Igitt!
Insekten, Würmer, Blutegel: Warum ekeln wir uns vor Tieren?
Um manche Tiere machen wir gerne einen grossen Bogen, weil wir uns ekeln. Warum das so ist, versuchen verschiedene Theorien zu erklären.
Schleimige Schnecken, sich ringelnde Würmer, fette Maden und haarige Spinnen lösen bei den meisten Menschen ein unangenehmes Gefühl hervor: Ekel. Er dient dabei ursprünglich einem wichtigen Zweck, denn er soll uns vor Krankheiten schützen. Die körperliche Reaktion von Ekel zeigt das deutlich. Übelkeit, Würgen und Erbrechen hindern uns daran, aus Versehen etwas zu verschlucken oder im Magen zu behalten, was uns krank machen kann. Auch zieren wir uns ganz besonders davor, etwas anzufassen, was wir als eklig empfinden. Bei manchen mit Ekel behafteten Tieren ergibt dies durchaus Sinn. Die Maden von Fliegen und verschiedenen Käfern entwickeln sich in Kadavern, also in verwesendem Fleisch. Ihre Anwesenheit warnte folglich bereits unsere Vorfahren vor potenziellen Schäden, nämlich davor, verdorbenes Fleisch zu essen oder eine Gefahr zu übersehen, durch die sie wie der tote Artgenosse enden könnten.
Andere als eklig empfundene Tiere sind Krankheitsträger, wie Mäuse, Ratten oder verschiedene…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.




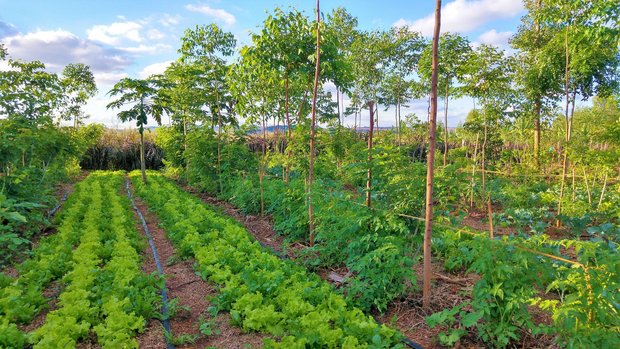











Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren