Nutztiere
Waldweiden: Biodiversität fördern oder Naturräume gefährden?
Die einen sehen in der Waldweide eine Chance für mehr Biodiversität, andere monieren, Rinder und Co. hätten im Wald nichts zu suchen. Wo macht diese Art der Waldnutzung Sinn und wie gelingt ein friedliches Miteinander?
Eichhörnchen, Specht, Fuchs, Reh – im Wald treffen wir immer wieder auf Tiere. Doch Ziegen, Schafe, Schweine oder Rinder zwischen Buchen, Tannen und Eichen? «Vor 150 Jahren waren Nutztiere im Wald völlig normal», sagt Serge Buholzer, Leiter Team Biodiversitätsförderung bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung. Der Wald entpuppte sich mit seinen vielfältigen Kräutern, Gräsern, Laub, Eicheln und Bucheckern für Nutztiere als gefundenes Fressen.
Den Tieren schmeckte es – mitunter allzu gut: Immer grösser werdende Viehbestände und starker Holzschlag schwächten die Wälder zusehends, sie wurden lichter und fragiler. Eine Lösung musste her. Im Jahr 1902 besiegelte das Forstpolizeigesetz schliesslich das Aus der Waldweide. Das gesetzlich verankerte Verbot hatte aber nicht nur Vorteile: Die Wälder erholten sich und wurden wieder dichter und dunkler, doch licht- und wärmeliebende Tiere und Pflanzen verloren ihrenangestammten Lebensraum und verschwanden…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.












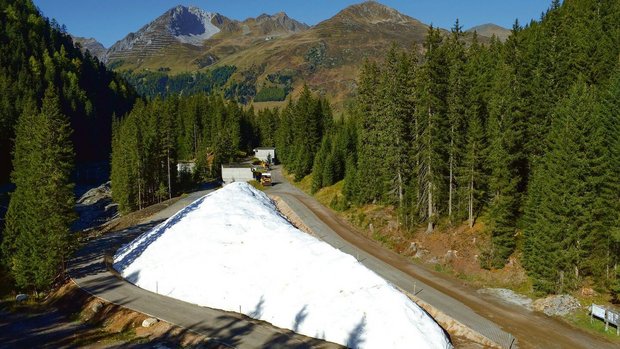



Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren