Nachhaltige Wassermelonen
Schweizer Wassermelonen: Süss, saftig und regional
Wassermelonen gehören zu den beliebtesten Sommerfrüchten. Als Importprodukt gilt sie jedoch nicht als besonders klima- und umweltfreundlich. Bruno Hurni schafft hier Abhilfe: Er baut im Seeland Schweizer Wassermelonen an.
Melonen gehören zum Sommer wie die Badi und das Bräteln. Doch bei manch einem meldet sich beim Griff zur Wassermelone im Supermarkt das schlechte Gewissen. Wie weit ist die Frucht wohl geflogen? In Zeiten der Klimakrise, in denen der Ruf nach Nachhaltigkeit und damit auch Regionalität immer grösser und wichtiger wird, gilt der Verzehr von exotischen Früchten zunehmend als No-Go. Im Ausland angebautes Obst wird oft noch unreif gepflückt und über Tausende Kilometer um die halbe Welt geschifft oder geflogen, bis es auf unserem Tisch landet. Nachhaltigkeit geht anders.
Dank Bruno Hurni gibt es, zumindest was Wassermelonen betrifft, jedoch eine Lösung. Der Seeländer baut das Kürbisgewächs in Gurbrü (BE) an. «Wassermelonen bestehen zu 95 Prozent aus Wasser. Und es kann nicht sein, dass wir praktisch Wasser importieren», so der Landwirt. Wegen des zunehmend heissen und trockenen Klimas gedeihen die Früchte auch in der Schweiz. So macht sich Hurni den Klimawandel zunutze und setzt…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.








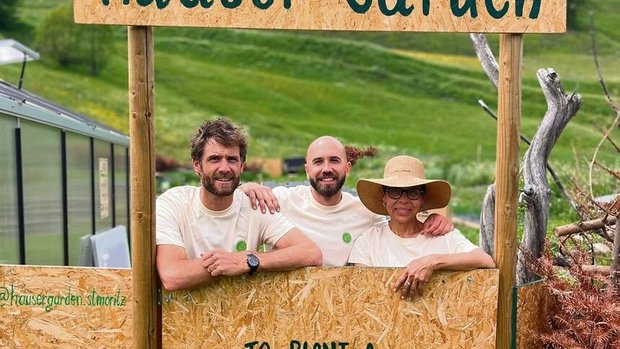








Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren