Streifzug durch die ländliche Schweiz
Bauernhausforschung auf dem Ballenberg im Berner Oberland
Bauernhöfe prägen die Landschaft. Auf der kleinen Fläche der Schweiz bildeten sich unterschiedliche Baustile heraus, je nach Art der Landwirtschaft oder nach der Topografie des Geländes. Welche Geschichten verbergen sich hinter den Höfen? Ein Rundgang durch die bäuerliche Landschaft der ganzen Schweiz, vom behäbigen Bauernhof bis zu Taunerhäusern.
Gackernde Hühner, Kühe auf der Weide, trompetende Gänse am Teich, Ziegen, die Blätter von der Hecke zupfen. Ein Bauernhof ist ein Anziehungspunkt. Umgeben von Obstbäumen und einem üppigen Garten mit Blumen und Gemüse steht er an der Sonnseite einer hügeligen Idylle. Am Horizont der Wald, unten im Tälchen murmelt ein Bach.
So idealistisch wird das ländliche Leben oft inKinderbüchern dargestellt. Das ist nicht reine Fantasie. Tatsächlich haben viele schöne Erinnerungen an Tage auf dem Land. Die Vielfalt der auf Bauernhöfen gehaltenen Tiere war gross, die Landschaft ist lieblich. Sind die Vorstellungen realistisch oder wird hier einem Bild gehuldigt, das es längst nicht mehr gibt?
Alte Höfe sind zweifellos noch da, doch neue kommen hinzu. Sie entsprechen so gar nicht mehr der Erinnerung an längst vergangene Tage. «Die landwirtschaftliche Architektur wirkt heute vereinheitlicht», sagt Riccarda Theiler. Die Kunsthistorikerin und Steinmetzin ist Bereichsleiterin Architektur und…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 14 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?
Hier einloggen.











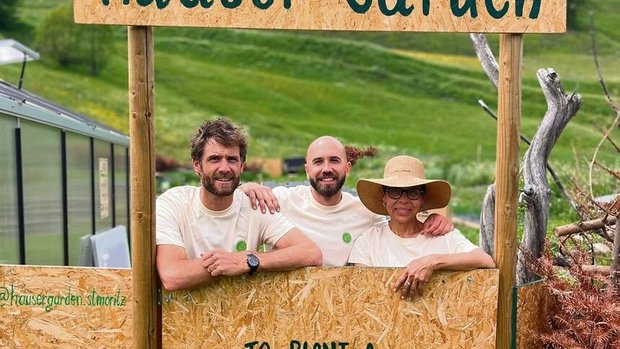










Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren