Maskierter Neuling
So leben Waschbären in der Schweiz
Mit seiner schwarzen Maske und dem flauschigen Fell sieht er niedlich aus, der Waschbär. Ursprünglich aus Nordamerika kommend, breitet er sich auch bei uns zunehmend aus. Über seine Daseinsberechtigung scheiden sich die Geister.
Ein maskierter Räuber überquerte 1976 von Deutschland aus die Grenze zur Schweiz. Seitdem breitete sich der Waschbär (Procyon lotor) über weite Teile des Mittellands aus. Mittlerweile gibt es auch aus dem Wallis und dem Rheintal vereinzelt Sichtungen. Die vermehrten Beobachtungen machen manch einen mit Blick auf unseren nördlichen Nachbarn nervös. Dort steigen mit den Populationszahlen auch die Sorgen der Umweltschützer und der Unmut in der Bevölkerung. Was macht den putzigen Maskenträger einerseits so erfolgreich, andererseits aber so unbeliebt?
Alles begann 1934 mit einer – im Nachhinein gesehen – nicht sonderlich guten Idee. In Nordhessen (Deutschland) wurden zwei trächtige Waschbärweibchen ausgesetzt, um «die heimische Fauna zu bereichern». Die beiden gelten als eine der Keimzellen der heutigen deutschen Waschbärpopulation. Vielerorts wurden Waschbären zudem auf Pelztierfarmen gehalten und teilweise auch freigelassen. Nicht zuletzt traf 1945 eine Fliegerbombe eine Waschbärzucht östlich von Berlin und verhalf 25 Tieren zur Freiheit. So war es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis der Waschbär den Weg über die Grenze in die Schweiz fand.
In seiner nordamerikanischen Heimat besiedelt der Waschbär bevorzugt gewässerreiche Laub- und Mischwälder, fühlt sich aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit jedoch auch in vielen anderen Lebensräumen wohl. Sogar in Grossstädten wie New York hält der Kletterkünstler Einzug. Hier macht er sich auch in Abfällen auf die Suche nach Fressbarem. Ansonsten ernährt er sich von Pflanzenteilen, kleinen Tieren und manchmal sogar Aas. Sprich: Er ist ein Allesfresser und Opportunist. Er kann hervorragend schwimmen und klettern, ist sehr intelligent und experimentierfreudig. Dies verhalf dem Waschbären auch in Europa zum Siegeszug.
Sein Ausbreitungsdrang ist vielen ein Dorn im Auge. In den Städten durchwühlt der nachtaktive Waschbär im Schutz der Dunkelheit Mülleimer und Komposthaufen, dringt in Gebäude ein, plündert Obstbäume und Vorratskammern. Mancher Hausbesitzer sieht im Waschbären einen unliebsamen Untermieter. Wenn dieser sich dazu entscheidet, auf einem Dachboden seine Jungen grosszuziehen, so kommt nebst dem Lärm durch die lebhaften und neugierigen Jungtiere auch eine intensive Geruchsbelästigung durch Urin und Fäkalien hinzu.
[IMG 6]
Eine Gefahr für die Natur?
Viele Jäger und Naturschützer halten den Kleinbären auch für eine Gefahr für das heimische Ökosystem. Als Allesfresser bedient er sich nicht nur an den Eiern von Singvögeln, sondern macht auch Jagd auf seltene Tiere wie die Sumpfschildkröte. «Diese leidet jedoch nicht nur unter dem Waschbären, sondern vielmehr unter dem Verlust ihres natürlichen Lebensraums», erklärt der deutsche Biologe Ulf Hohmann in einem Interview gegenüber dem Südwest-Rundfunk (SWR2). Der Waschbär könne mit seiner Gefrässigkeit der Sargnagel für die bedrohte Reptilienart sein, die Vorarbeit hat aber der Mensch geleistet.
«Im Grossen und Ganzen ist der Waschbär keine Gefahr für die Artenvielfalt», ist Hoffmann überzeugt. Er untersucht seit 2001 verschiedene Aspekte rund um den in Europa neuen Kleinbären und schrieb unter anderem ein Buch über seine Erkenntnisse. Anders einige Jäger, die den Waschbären vielerorts regelrecht zum Lieblingsfeind erkoren haben. In der Jagdsaison 2022/21 wurden in Deutschland über 200 000 Waschbären geschossen. «Demnach ist die Jagd mit Falle und Waffe das wirkungsvollste tierschutzgerechte Instrument, um die Ausbreitung einzudämmen», heisst es auf der Internetseite des Deutschen Jagdverbandes. Ulf Hofmann hat seine Zweifel daran: «Der Waschbär ist dermassen erfolgreich in Mitteleuropa, dass die Idee, man können ihn wieder loswerden, eigentlich etwas absurd erscheint.» Er sei da und er sei gekommen, um zu bleiben.
Auch Gabriel Sutter vom Amt für Wald im Kanton Baselland sieht den Waschbären nicht direkt als Bedrohung für die Schweizer Natur: «Man weiss schlicht noch viel zu wenig über den Einfluss des Waschbären auf die einheimischen Arten.» Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach, stimmt dem zu: «Aktuell ist der Waschbär noch keine relevante Gefahr, zum Beispiel für unsere Bodenbrüter, weil er bislang nur sehrsporadisch auftritt.» Erfahrungen aus Mitteleuropa würden aber zeigen, dass er insbesondere den Bruterfolg von Feuchtgebietarten stark vermindern kann.
[IMG 4]
Tatsächlich gibt es sehr wenige wissenschaftliche Studien zum Einfluss des Waschbären auf die einheimische Fauna. In Sachsen-Anhalt (Deutschland) ging die Anzahl brütender Graureiherpaare zurück, als die Beobachtungen von Waschbären sich häuften. Auch die Bestände der Rot- und Schwarzmilane nahmen ab. Meldungen, dass Waschbären die Nester von Milanen ausräumten und auch von Singvögeln genutzte Nestboxen plünderten, gibt es auch aus anderen Regionen Deutschlands. Wie stark dies den Bestand und den Bruterfolg der Vögel gefährdet, ist indes nicht bekannt.
Ob der Waschbär eine Gefahr für die Schweizer Vogelwert werden würde, hänge im Grossen und Ganzen davon ab, wo und wie sich die Bestände des Waschbären künftig entwickeln werden, so der Biologe Rey. Auch Wildhüter Gabriel Sutter wünscht sich eine bessere Faktenlage. Entsprechende Studien würden mehr Klarheit darüber bringen, was es wirklich bedeutet, dass Waschbären auch bei uns auf dem Vormarsch sind. Momentan werde viel zu sehr auf Vermutungen und Emotionen basierend argumentiert. «Nicht zuletzt würden harte Fakten auch der Diskussion dienen, ob und wie gegen den Waschbären vorzugehen ist», merkt Sutter an.
Schon gewusst?Seinen Namen trägt der Waschbär wegen einer für ihn typischen Verhaltensweise: Er bewegt seine Nahrung mit den Vorderpfoten prüfend hin und her, was gerade in seinem bevorzugten Lebensraum in der Nähe von Wasser den Eindruck erweckt, als würde er seineNahrung waschen. Grund für das ausgiebige Befühlen ist der hochentwickelte Tastsinn, mithilfe dessen der Waschbär in der freien Natur vor allem in Gewässern und im Uferschlamm nach Fressbarem sucht.
Dem Tod geweiht
Das Ob und Wie gibt hierzulande zurzeit die Freisetzungsverordnung (FrSV) vor. Im Artikel 15, Absatz 2 steht wörtlich: «Mit invasiven gebietsfremden Organismen darf in der Umwelt nicht direkt umgegangenwerden; ausgenommen sind Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen.» Laut Jagdgesetz wird der Waschbär das ganze Jahr bejagt, ohne Schonfrist, und muss der Natur entnommen werden. Die Umsetzung des Jagdrechts ist dabei Sache der Kantone. In Baselland bedeutet dies: Wird ein Waschbär gesichtet, wird er, wenn immer möglich, getötet. «Wir versuchen damit noch, die Ausbreitung zu stoppen», erklärt Gabriel Sutter. «Die erste Reaktion auf eine gebietsfremde Art scheint immer zu sein, ‹da muss man etwas machen!›.» Ob das längerfristig Sinn mache, sei eine andere Frage.
Da Waschbären meistens im Siedlungsbereich gesichtet werden, fängt Sutter die Tiere mit Lebendfallen und erlegt sie anschliessend in einem Gebiet, wo er schiessen darf. Nicht immer stösst er damit auf Verständnis, und er hätte es auch schon erlebt, dass die Anwohner vergeblich bei Tierparks angerufen haben, um sich zu erkundigen, ob diese Waschbären aufnehmen würden. Die Reaktion sei aus menschlicher Sicht verständlich, sagt Sutter. Auch er würde die Tiere niedlich finden und gerade, wenn er Welpen in den Fallen hätte, ist der Zwiespalt gross. Man merkt, dass es auch ihm keinen Spass macht, die Tiere töten zu müssen. «Wer aus Lust am Töten Jäger oder Wildhüter wird, der ist falsch im Job.» Ein gesundes Tier zu erlegen, sei immer schade, zumal der Waschbär auch in keiner Art und Weise verwertet werden könne. Sein Fleisch werde nicht gegessen, und der Pelz sei heutzutage auch uninteressant geworden. Die geschossenen Tiere würden schlussendlich in der Kadaversammelstelle landen.
«Es leben mehr Waschbären bei uns, als wir denken.»
Es scheint eine Sisyphusarbeit zu sein, denn die Sichtungen nehmen nicht nur im Kanton Baselland zu, sondern in der ganzen Schweiz. Im Nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Fauna (info fauna, CSCF) kann man auf der Karte jahrweise die Ausbreitung des Waschbären sehen. Gab es bis 1980 erst vereinzelte Meldungen aus der Nordschweiz, so erreichte der Waschbär 1985 das Berner Oberland, 2003 den Genfersee und das Wallis, 2011 schlussendlich auch Graubünden. Sutter überrascht das nicht: «2021 hatten wir in Baselland mehrere Weibchen mit Jungtieren.» Gerade im Siedlungsraum würden sich die Waschbären zunehmend ausbreiten. 2022 waren es bereits 20 Tiere, die der Natur entnommen wurden, Verkehrsopfer mitgezählt. «Die Dunkelziffer ist sicher hoch, sprich: Es hat mehr Waschbären, als wir denken», sagt Sutter. Der Wildhüter würde sich wünschen, dass in der Bevölkerung ein grösseres Bewusstsein für die Präsenz der Tiere herrscht. «Viele wissen gar nicht, dass der Waschbär schon in der Schweiz vorkommt, wieder andere halten ihn für einheimisch.»
Siedlungen unattraktiv machen
Gabriel Sutter wäre es wie vielen lieber, wenn er gar nicht erst handeln müsste. «Dafür darf man es dem Waschbären aber auch nicht so leicht machen, wie er es zurzeit noch hat. Die Siedlungsräume bieten ein wahres Schlaraffenland.» Offene Mülleimer und Komposthaufen, Schalen mit Katzenfutter für die Freigängerbüsis, viele Versteckmöglichkeiten, das locke den Kleinbären an. Eigentlich sei der Waschbär ein Waldbewohner, erklärt Sutter. «Er kommt sicher nicht zu uns, weil er Menschen so toll findet, sondern weil deren Siedlungsabfälle einfachere Nahrungsquellen sind.» Ein entsprechendes Kehricht- und Gartenmanagement würde Städte und Dörfer für den Waschbären weniger attraktiv machen.
[IMG 2]
Mit der Attraktivität hat auch Japan zu kämpfen. Auf dem Inselstaat hat sich der Nordamerikanische Waschbär ebenfalls stark ausgebreitet. Grund dafür ist eine in den 70er-Jahren beliebte Zeichentrickserie «Araiguma Rasukaru» (Rascal, der Waschbär). In der TV-Serie findet ein Junge einen Waschbärwelpen im Wald und zieht ihn auf. Nach neun Monaten voller Abenteuer stellt der Bub fest, dass Waschbären keine guten Haustiere sind, und entlässt das Tier in die Freiheit. Trotzdem hinderte diese Erkenntnis der Zeichentrickfigur viele Japaner nicht daran, sich eines der putzigen Tiere als Haustier ins Land zu holen. Einmal ausgewachsen, zeigt sich jedoch das wilde Wesen des Waschbären, und so taten es viele japanische Halter ihrem Zeichentrickpendent gleich und entledigten sich des Tieres.
Ohne Fressfeinde konnten sich Waschbären so auch in Japan praktisch ungestört vermehren. Gerade Landwirte beschweren sich seitdem über die Schäden, welche die Tiere anrichten. Nicht zuletzt fühlen sie sich auch in Tempeln und Schreinen wohl, zumal sich in deren Umgebung oft Bäume und Wasser befinden. Die traditionellen Holzbauten Japans stellen für die Kletterkünstler kein Hindernis dar, und sie richten sich darin gerne häuslich ein. Selbst Füchse nehmen vor den maskierten Neulingen Reissaus, sodass die bisher durch die Rotpelze im Schach gehaltene Rattenpopulation lokal stark angestiegen ist. Als dann an einer buddhistischen Figur in einem Tempel in Kyoto Kratzer von scharfen Waschbärkrallen entdeckt wurden, war es mit der ursprünglichen Sympathie für das Tier definitiv vorbei.
Seither gilt der Waschbär auch in Japan als Staatsfeind Nummer eins und wird intensiv bejagt. In japanischen Städten können sich Bewohner Käfigfallen von der Stadtverwaltung ausleihen, um die Kleinbären einzufangen. Anschliessend holt die Stadtverwaltung die Tiere ab und tötet sie. Gleichzeitig verteilt die Regierung regelmässig Broschüren mit Tipps, um Waschbären vom Haus fernzuhalten. Dazu gehört, nebst dem Schliessen von potenziellen Einstiegen zum Dachboden, Mülltonnen und Kompostkübeln, auch die Vertreibung mit Lärm und bestimmten Gerüchen wie Lavendelsäckchen oder Mottenkugeln.
[IMG 3]
Moralischer Zwiespalt
Selbst wenn es in Japan gängige Praxis ist: Einfangen darf man das Tier bei uns als Laie nicht. Auch der Einsatz von Giftködern ist strengstens verboten. Besser sind Bewegungsmelder, die automatisch Licht einschalten oder Wasser versprühen lassen. Fühlt sich der Waschbär bei seinen nächtlichen Streifzügen gestört, sucht er sich ziemlich schnell einen anderen Platz. Das verschafft nicht nur den Hausbesitzern Zeit, sondern auch dem Tier selber. Denn dem Waschbären ergeht es wie vielen Tierarten, die einst ins Land geholt wurden, um sie zu nutzen, sei es als Pelzlieferant oder als Haustier: Wird er lästig, so muss er weg. Wie in vielen Bereichen ist auch hier nicht alles einfach nur schwarz oder weiss.
Es gibt viele Beispiele, in denen invasive Arten bereits heimische Tierarten ausgerottet haben, massive Schäden in der Landwirtschaft verursachen oder neue Krankheiten verbreiten. Die gängigste Gegenmassnahme war jeweils die rigorose Bekämpfung der Neulinge. Doch das flächendeckende, konsequente Abschiessen von Waschbären bringt viele Tierschützer auf den Plan. In einem Positionspapier forderten fünf Tierschutzorganisationen, darunter der Deutsche Tierschutzbund und die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., dass Tiere nicht getötet werden sollen, nur weil sie als invasiv gelten. «Dem Präventionsgedanken muss Vorrang eingeräumt werden», so das Schreiben. Es gelte, Strategien im Umgang mit als invasiv eingestuften Arten zu entwickeln, die prioritär tierschutzgerechte und nicht tödliche Massnahmen verfolgen.
Im Falle des Waschbären könnten die Tiere statt-dessen gezielt unfruchtbar gemacht werden, sei es durch Kastration oder flächendeckendes Ausbringen der «Anti-Baby-Pille». Der Deutsche Jagdverband hält dies angesichts der starken Ausbreitung für realitätsfern. Mehr als 130 000 Waschbären müssten in Deutschland gefangen und kastriert werden, damit die Aktion Wirkung zeigen würde. Kostenpunkt: umgerechnet rund 13 Millionen Franken. Entsprechende Studien oder gar Versuche zu einer Kastration gibt es allerdings nicht. Und dass auch Abschiessen nichts an der Populationszunahme des Waschbären ändert, zeigt die deutsche Jagdstatistik deutlich: Wurden 2009/2010 erst knapp 50 000 Tiere erlegt, so war es 2019/2020 bereits das Vierfache. Der Waschbär ist also eindeutig gekommen, um zu bleiben.
[IMG 7]
Waschbären als Haustier?
Auf Instagram und Co. sind Waschbären mittlerweile fast so beliebt wie Katzen und Hundewelpen. Die frechen Kleinbären wirken mit ihrer tapsigen Art und dem flauschigen Fell wie ideale Haustiere. Wie für alle Wildtiere ist die private Haltung von Waschbären in der Schweiz bewilligungspflichtig. Sie brauchen ein Aussengehege von mindestens 20 Quadratmetern mit Kletter- und Badegelegenheiten, und dürfen nicht einzeln gehalten werden. Die Halter müssen zudem über einen entsprechenden Sachkundenachweis verfügen. Nebst den rechtlichen Grundlagen muss beachtet werden, dass Waschbären keine zahmen Kuscheltiere sind. Sie sind nicht erziehbar und machen auch schon mal von ihren spitzen Zähnen Gebrauch. Clever und erfinderisch, wie sie sind, ist nichts vor ihnen sicher, und den Tieren wird schnell langweilig. Dann ist nicht nur die Wohnungseinrichtung dahin, sondern auch das artgerechte Leben des Wildtiers.
[IMG 5]




















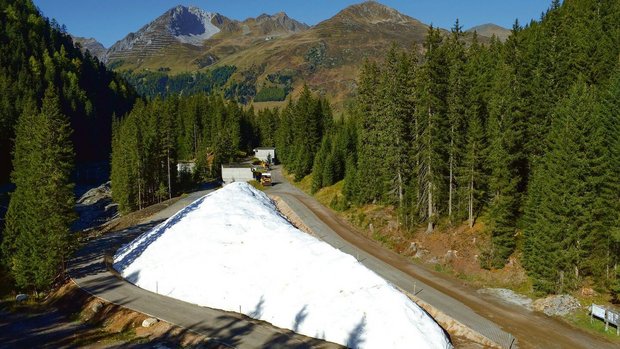

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren